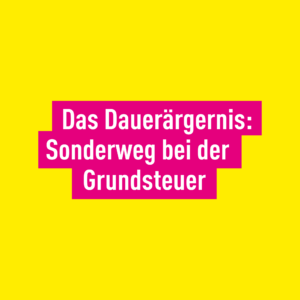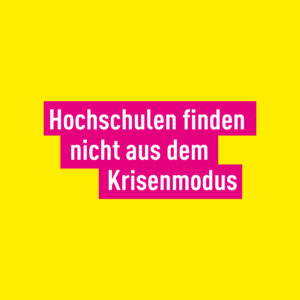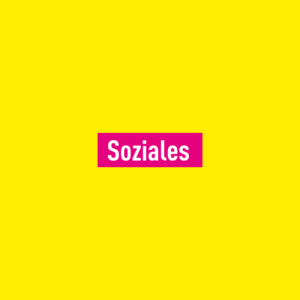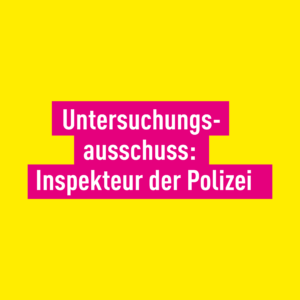Migration in Sozialsysteme begrenzen, Fachkräfteprogramm Tourismus gefordert.
Der Vorsitzende der FDP/DVP-Fraktion Dr. Hans-Ulrich Rülke, beurteilt die Halbzeitbilanz der grün-schwarzen Koalition im Landtag wie folgt:
„Wir haben uns als Fraktion die Bilanz der Landesregierung der letzten zweieinhalb Jahre angeschaut und sind zum Ergebnis gekommen, dass Grün-Schwarz bis zur Halbzeit in keinem einzigen Politikfeld brauchbare Ergebnisse geliefert hat. Einem sinnlosen neuen Ministerium und der sinnlosen Ernennung zusätzlicher Staatssekretäre um Parteigänger zu versorgen, steht insbesondere ein fataler Absturz im Kerngebiet der Landespolitik – der Bildung – entgegen.
Reihenweise letzte und vorletzte Plätze in den einschlägigen Bildungsrankings zeigen auf, wie sich Baden-Württemberg aus der ehemaligen Spitzengruppe um Bayern und Sachsen verabschiedet hat, um sich im tristen Mittelfeld und in einigen Bereichen am Tabellenende wiederzufinden. Die Gründe sind so bekannt, wie vielfältig und statt in der aktuellen Legislaturperiode gegenzusteuern, wird im Gegenteil das grüne Ideal der Leistungsfeindlichkeit noch weiterbefeuert. Die Diskussionen um die Bundesjugendspiele und die Grundschule ohne Noten untermauern das eindrucksvoll. Dieser verhängnisvollen Bilanz muss entgegengewirkt werden: Die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung, die Rückkehr zum G9 als Regelfall und die Gleichbehandlung aller Schularten liegen als offenkundige Lösungen auf dem Tisch. Sie müssen so schnell wie möglich umgesetzt werden!
Wo die Landesregierung ebenfalls schlecht aufgestellt ist, ist im Bereich der Migration, obwohl es insbesondere über den Bundesrat weitreichende Möglichkeiten gibt. Wir fordern zur Begrenzung irregulärer Migration die Zusage, dass Baden-Württemberg im Bundesrat zustimmt, dass Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden sowie eine Bundesratsinitiative, dass der Maghreb ebenfalls zu selbigen erklärt wird. Wenn die Grünen im Bund versuchen, Begrenzungsanstrengungen zu hintertreiben, müssen diese eben von den Ländern kommen. Ebenfalls muss Baden-Württemberg dringend darauf drängen, dass der Rechtskreiswechsel für ukrainische Flüchtlinge endlich rückgängig gemacht wird, um einen Pull-Faktor – nämlich das Bürgergeld – zu beseitigen und die Gleichbehandlung aller Flüchtlinge sicherzustellen. Eins ist für uns nämlich klar: Es müssen weniger werden, damit die Kreise und Kommunen nicht vollständig überfordert werden. Nur Geld weiterleiten und die Flüchtlinge verteilen reicht nicht.
Aber auch im Bereich der wünschenswerten Zuwanderung, um die Wirtschaft zu stärken, passiert so gut wie nichts. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz des Bundes bietet beste Voraussetzungen, um die wünschenswerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu stärken. Wir fordern deshalb ein Arbeits- und Fachkräfteprogramm Tourismus: ‚Gute Arbeit im Genießerland Baden-Württemberg‘ .
So kann das durch die Postenschachereien völlig entkernte Wirtschaftsministerium mit einer sinnvollen Maßnahme ergänzt werden. Durch aktive Werbung für eine Beschäftigung in der Tourismuswirtschaft kann die peinliche „Länd“-Kampagne abgelöst werden und mit ersten Sprachkursen im Heimatland flankiert der Einwanderungsprozess aktiv begleitet werden. Die Tourismusbetriebe sollten dabei nach ihren Bedarfen unterstützt und die bereits geförderten Welcome Center (WCC) genau dafür verwendet werden.
Nachdem die durch die rigiden Corona-Maßnahmen gebeutelten und im Anschluss hängen gelassenen Innenstädte mit Handel und Gastronomie immer noch massiv in Schwierigkeiten stecken, wäre das eine Maßnahme, um diese wieder zum Erblühen zu bringen. Die Innenstädte brauchen Hilfe statt Träumereien, auch noch das letzte Auto von dort zu vergrämen! Aber insgesamt braucht die Wirtschaft eine aktive Standortpolitik als Soforthilfe. Weg mit dem Ziel des Netto-Null-Flächenverbrauchs und übertriebenen Arten- und Umweltschutzanforderungen. Weniger Eidechsenzählen, mehr Jobs und wirtschaftliche Prosperität.
Hier schließt die fehlende Digitalisierung nahtlos an. Unter Digitalisierungsminister Thomas Strobl ist Baden-Württemberg Letzter im bundesweiten Vergleich bei Glasfaseranschlüssen und dem neuesten Mobilfunkstandard. Und dieses trotz einer im Schnitt verdoppelten Breitbandförderung durch die Bundesregierung im Vergleich zu den Jahren vor 2021. Ein Gutscheinmodell für die letzten Meter vom Bordstein zum Haus muss ebenso her, wie eine zentrale Dienstleistungsplattform, um medienbruchfrei Verwaltungsvorgänge digital ausführen zu können. Die Digitalisierung einzelner Prozesse wie aktuell bei den Kommunen abzuladen ist nicht zielführend.“
Die Halbzeitbilanz im Detail finden Sie hier: https://fdp-landtag-bw.de/halbzeitbilanz/