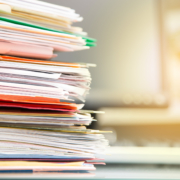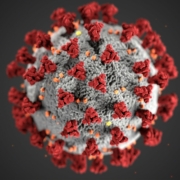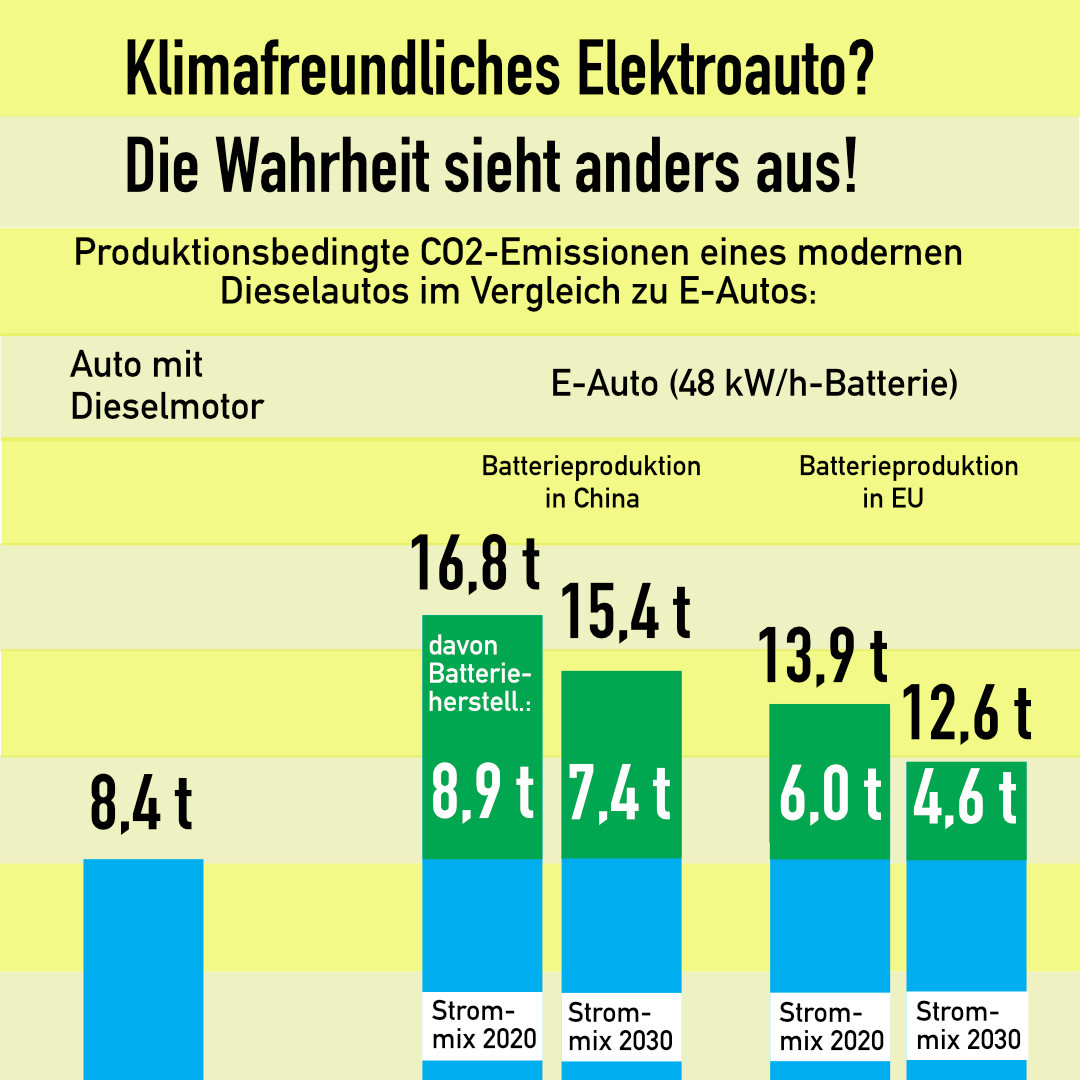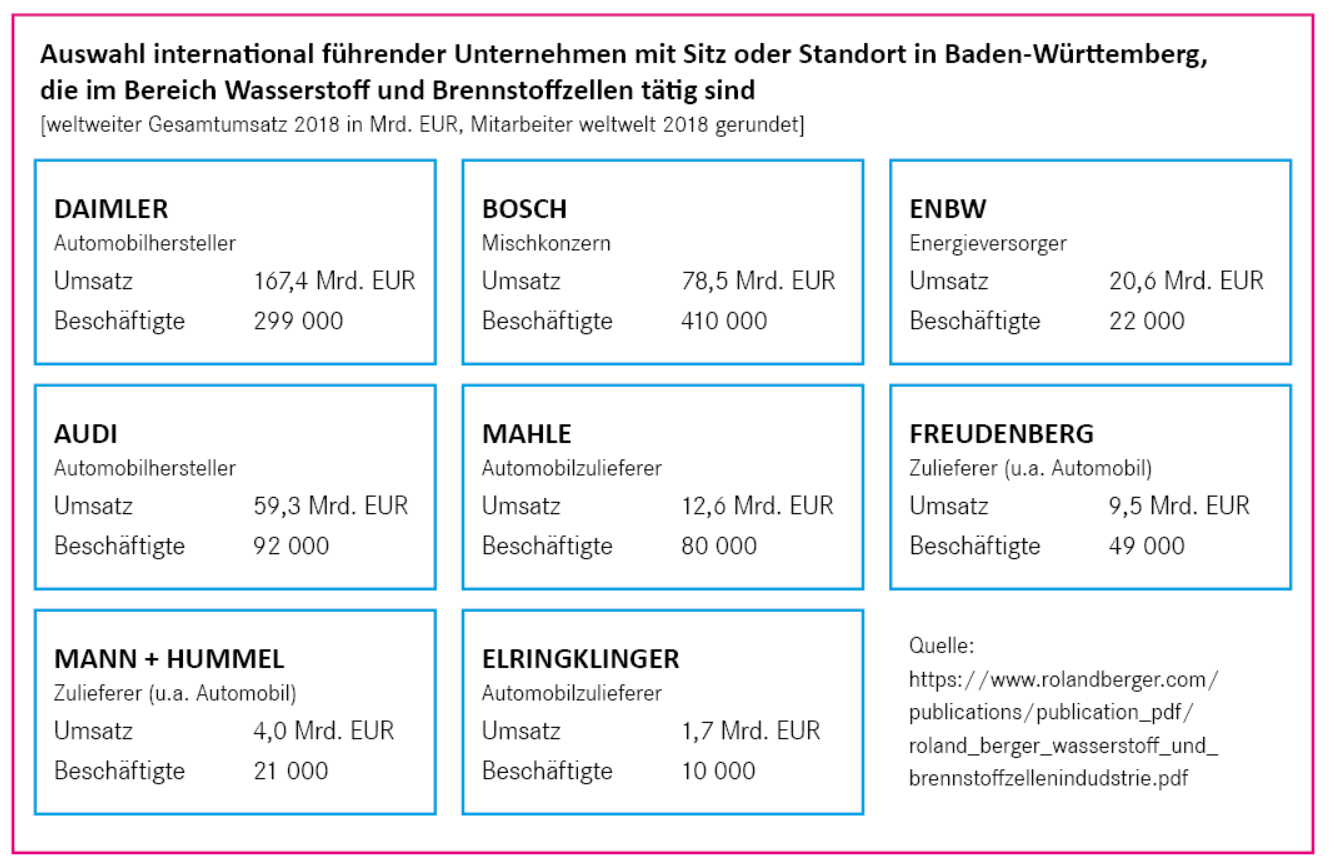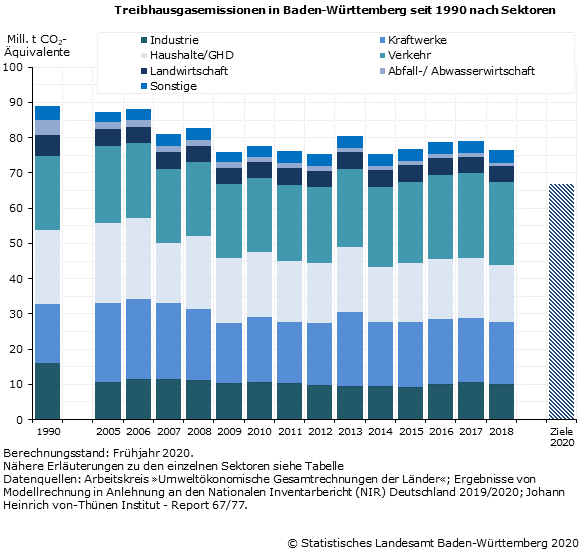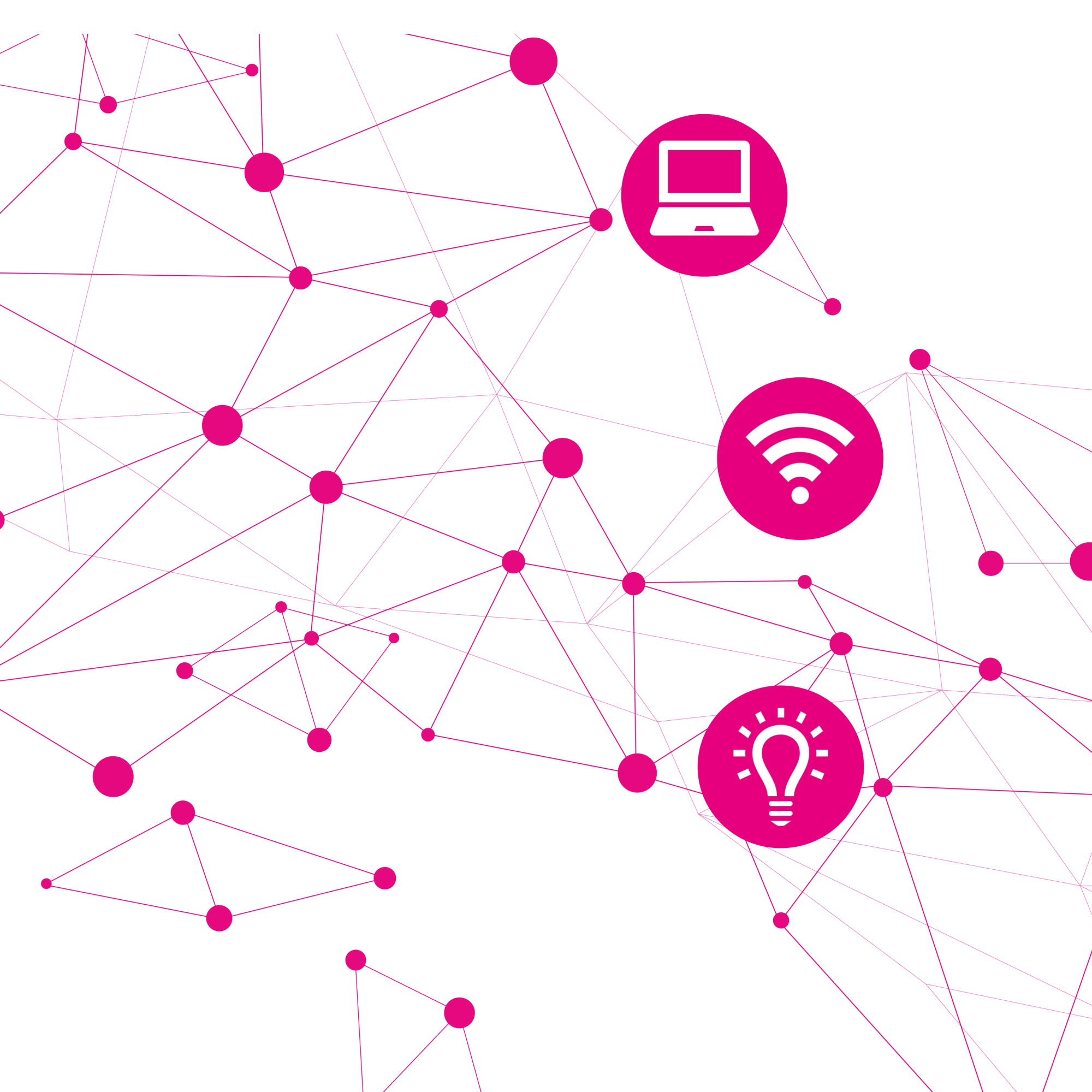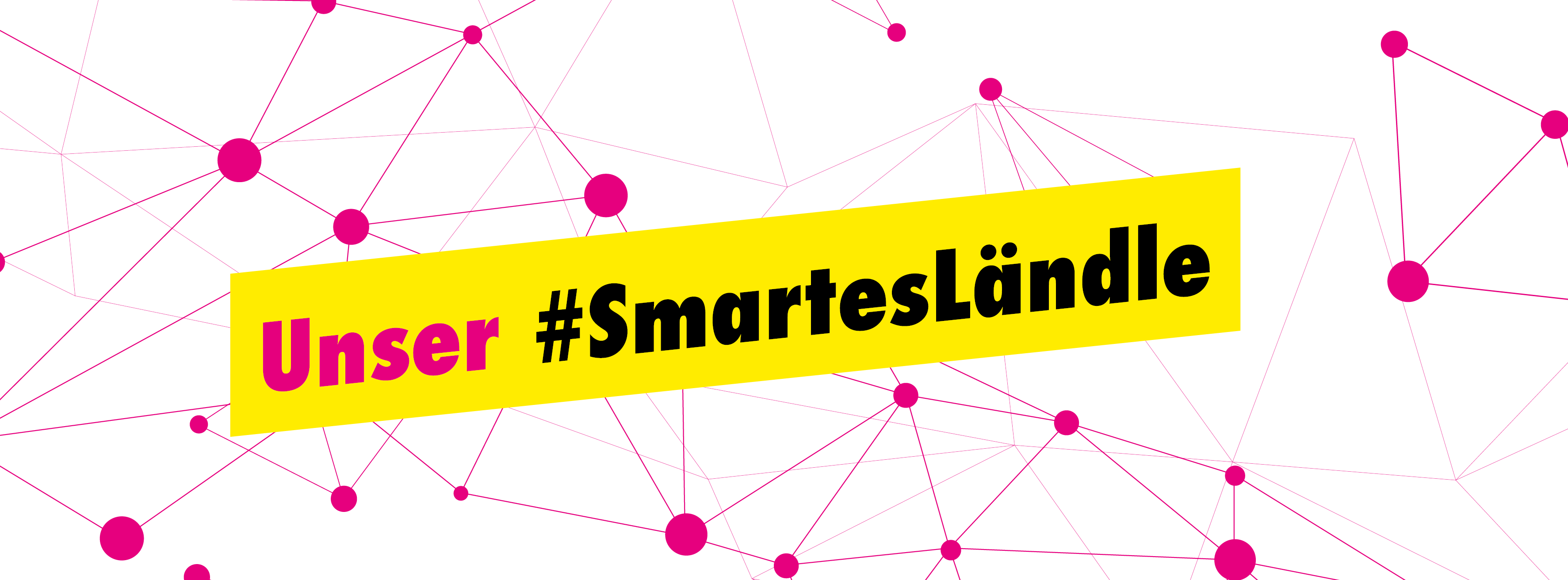Die Haushaltsberatungen – ein Blick hinter die Kulissen
„Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann“, singt Johanna von Koczian in einem berühmten deutschen Schlager. Doch das stimmt sowohl weder im Privaten (die Deutschen verbringen ca. drei Stunden täglich mit Haushaltsarbeit) und schon gar nicht in der Politik. Im Gegenteil, der Haushaltsplan ist ein Produkt eines mehrmonatigen Prozesses mit Beratungen, Diskussionen und Änderungen.
Die Antworten hierzu finden sich im Haushaltsplan der Landesregierung, der die Ziele und Aufgaben des Landes sowie deren Finanzierung festlegt.
In diesem Jahr wird der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 verabschiedet. Der Vorteil, dass der Haushalt bereits für die kommenden zwei Jahre beschlossen wird, liegt darin, dass die Landesregierung entlastet wird und somit Ressourcen eingespart werden. Da es jedoch des Öfteren zu unvorhergesehenen Entwicklungen kommt, wird ein Doppelhaushalt in darauffolgenden Jahren zumeist um so genannte Nachtragshaushalte ergänzt. Gegliedert ist der Haushaltsplan in 18 Einzelpläne, welche jedem Ressort zugewiesen sind. In den Einzelplänen schlägt das zuständige Ministerium u.a. Einnahmen und Ausgaben für den entsprechenden Bereich vor.
Phase 1: Die Landesregierung arbeitet den Haushalt aus
Der Haushalt 2023/24 wurde im Oktober 2022 von dem Kabinett mit einem Volumen von insgesamt 121,4 Mrd. € (2023: 61 Mrd. €; 2024: 60,4 Mrd.€) ausgearbeitet. Ein Merkmal kennzeichnet alle Regierungen Kretschmann, und das setzt sich auch in diesem Haushalt fort: Die Ausgaben steigen rasant. Was wiederum die Landesregierung nicht davon abhält, uns einen Haushalt zu präsentieren, der keine Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger enthält.
Dieser Haushalt ist alles andere als ein Sparhaushalt. Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus!
Phase 2: Der Etat wird in das Parlament eingebracht
Der Entwurf zum Doppelhaushalt der Jahre 2023 und 2024 wurde am 26. Oktober 2022 von Finanzminister Dr. Danyal Bayaz ins Parlament eingebracht. Damit starten die parlamentarischen Beratungen über den Staatshaushaltsplan. Das Prozedere gehört zum so genannten Etat-oder Haushaltsrecht, welches auch als Königsrecht des Parlaments bezeichnet wird. Demnach muss die Landesregierung die Abgeordneten über sämtliche Ausgaben informieren und jede davon über den Haushaltsplan vom Parlament bewilligen lassen. Damit kommt unserer Fraktion als Teil der Opposition eine wichtige Kontrollfunktion zu.
Phase 3: Beratungen in den Arbeitskreisen der Fraktion
Nachdem die Finanzministerin den Haushaltsplan im Plenum vorgestellt hat, folgen die Beratungen in den Arbeitskreisen der Fraktionen. Arbeitskreise befassen sich mit je einem Themenbereich und bestehen aus den fachlich zuständigen Abgeordneten und parlamentarischen Beratern.
Phase 4: Die erste Beratung im Parlament
Eine Woche nach der Einbringung des Haushalts haben Abgeordnete aller Fraktionen die Möglichkeit, Stellung zur Rede der Finanzministerin zum Staatshaushaltsplan zu nehmen. Unser Fraktionsvorsitzender Dr. Hans-Ulrich Rülke nutzte diese Redemöglichkeit, um auf Schwachstellen im Haushalt hinzuweisen und Verbesserungsvorschläge basierend auf den Arbeitskreisberatungen zu präsentieren.
Unser Fazit fällt deutlich aus:
Es handelt sich hierbei insgesamt um einen Haushalt, der die Probleme der Gegenwart nicht löst und in unverantwortlicher Dreistigkeit eine wachsende Schuldenlast künftigen Generationen auferlegt.
Dr. Hans-Ulrich Rülke, Fraktionsvorsitzender
Phase 5: Beratungen im Finanzausschuss
Entwicklung des Haushalts über die Jahre
Der Haushaltsumfang belief sich 1996 noch auf 31,8 Milliarden Euro, 2011 – nach 15-jähriger Regierungszeit der FDP – dann auf 35,1 Milliarden Euro . Dies entspricht einem Anstieg von gut 10 Prozent. Dem gegenüber stehe das derzeitige Haushaltsvolumen von 61,0 Milliarden Euro, was in den 12 Jahren unter dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann einen Anstieg von 75 Prozent bedeutet.
Und was sagen die anderen Fraktionen zu dem Vorschlag der Liberalen? Das erfuhren die Abgeordneten in den Beratungen im Finanzausschuss, welche sich über mehrere Tage erstreckten. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen diskutierten unsere Abgeordneten die Änderungsanträge der anderen Fraktionen. Welchen Änderungen können wir zustimmen, welche lehnen wir ab? Mit dieser Position gingen die zuständigen Abgeordneten in ihrem jeweiligen Fachgebiet in die Beratung, um dort mit den Kollegen der anderen Fraktionen die Änderungsanträge der Oppositions-und Regierungsfraktionen zu diskutieren.
Die Landesregierung predigt schwierige Zeiten, vergisst aber das Sparen. Die Menge an Ausgaben, die jetzt nach der Steuerschätzung plötzlich möglich wurden, ist enorm. Dabei sieht die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse vor, sich gegen zukünftige Einnahmeausfälle zu wappnen. Doch dies geschieht einerseits zu zaghaft, andererseits verfrüht.
Phase 6: Die zweite Beratung im Parlament
Auf die Haushaltsberatungen im Finanzausschuss folgt die zweite Beratung im Parlament. Hier werden binnen drei Tagen alle Einzelpläne diskutiert und nochmals Änderungsanträge eingebracht. Doch das Schicksal einer Oppositionspartei ist, dass auch für die Zukunft unsere Anträge keine Mehrheit im Parlament finden. Wir kritisieren u.a
Der Landesregierung fällt die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen in den Schoß. Durch die bevorstehende Rezession kann man 1,2 Milliarden Schulden machen, statt 421 Mio zu tilgen. Grün-Schwarz greift sofort zu, denn Schuldenmachen ist ja auch viel einfacher als zu Sparen.
Same procedure as every year!
Phase 7: Die dritte Beratung im Parlament
Eine Woche nach der zweiten Beratung folgt die dritte und letzte Beratung im Plenum. Da die Einzelpläne bereits im Vorfeld besprochen wurden, geht es in dieser Debatte primär um grundsätzliche Erwägungen zum Haushalt. Die Haushaltsberatungen schließen mit der Schlussabstimmung, in welcher der Haushalt in der Regel angenommen wird.
Und so zeigt sich: Das bisschen Haushalt macht sich zumindest in der Politik nicht von allein.
is
Aufklärung war dringend erforderlich
Am 14. Oktober 2020 hat der Landtag auf Antrag von FDP/DVP und SPD mit den Stimmen aller fünf Fraktionen die Einrichtung des Untersuchungsausschusses „Abläufe in Zusammenhang mit der Beteiligung des Landes an der Weltausstellung 2020 (UsA Baden-Württemberg-Haus)“ beschlossen. Er war damit der dritte Untersuchungsausschuss in der 16. Legislaturperiode. Die Einsetzung des UsA Baden-Württemberg-Haus war erforderlich um aufzuklären, wie es dazu gekommen ist, dass das Land für den Baden-Württemberg-Pavillon auf der Expo in Dubai voll verantwortlich geworden ist und das Land dadurch mit mindestens 15 Millionen Euro in der Haftung steht. Ursprünglich war nur eine Landesbeteiligung in Höhe von 2,8 Millionen Euro geplant und die Teilnahme Baden-Württembergs an der Weltausstellung sollte als Projekt „Von der Wirtschaft für die Wirtschaft“ durchgeführt werden. Die Idee war gut, deshalb haben wir die Teilnahme von Baden-Württemberg an der Expo Dubai unterstützt, die Umsetzung und Koordination durch das Wirtschaftsministerium war schlecht. Sie überließen das Projekt vollständig einer externen Projektgesellschaft, bestehend aus Ingenieurkammer Baden-Württemberg, Fraunhofer Institut und Messe Freiburg, ohne sich um die Folgen für das Land zu kümmern. Die Idee, unser Bundesland auf der Weltausstellung stolz zu repräsentieren, hat durch das Missmanagement von Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut schweren Schaden genommen! Der Untersuchungsausschuss war insbesondere auch deshalb erforderlich, weil Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut bis heute keine Konsequenzen aus den Fehlern und ihrem Missmanagement gezogen hat. Wie wenig sie sich mit den Vorgängen beschäftigt haben muss, wurde bereits bei ihrer Vernehmung zum Auftakt der Beweisaufnahme deutlich, bei der sie sehr verunsichert wirkte und die Verantwortung für die gemachten Fehler auf die „handelnden Personen“ – sprich die Mitarbeiter der Arbeitsebene – schob. Das spricht Bände!
Bereits die Grundannahmen waren fehlerhaft
Das eklatante Missmanagement hat seine Ursachen augenscheinlich insbesondere darin, dass die Verantwortlichen im Wirtschaftsministerium das Projekt um jeden Preis umsetzen wollten, dabei aber unfähig oder unwillig waren, es in die richtigen Bahnen zu führen. Schon die Grundannahmen des Projekts waren fehlerhaft, wie im Untersuchungsausschuss deutlich geworden ist.
Das Wirtschaftsministerium hat von Anfang an wenig Wirtschaftskompetenz gezeigt:
Missmanagement im Wirtschaftsministerium
Durch die gute und effektive Arbeit des Untersuchungsausschusses konnten die Vorkommnisse rund um das Missmanagement des Expo-Projekts aufgeklärt werden. Die damalige Abteilungsleiterin im Wirtschaftsministerium und heutige Landespolizeipräsidentin Frau Dr. Hinz hat den Geschäftsführer der Ingenieurkammer Baden-Württemberg gegenüber der Expo-Gesellschaft in Dubai zum Bevollmächtigten des Landes Baden-Württemberg ernannt. Dabei will sie nicht gewusst habe, welche Rechte und Pflichten ein solcher Bevollmächtigter innehat.
Dieser Bevollmächtigte hat dann am 30.01.2019 einen Vertrag unterschrieben, der im Rubrum „Baden-Württemberg“ als Vertragspartner nennt. Man braucht kein Jurist zu sein und erst recht keine vertieften Kenntnisse im arabischen Recht zu haben, um erkennen zu können, dass dadurch eine vertragliche Bindung für das Land im Raum steht. Deshalb verwundert es nicht, dass nahezu alle Beteiligten außerhalb der Landesregierung genau davon ausgegangen sind! Nicht zuletzt die Vertragspartner in Dubai.
Bereits Anfang Februar 2019 lag der Vertrag dann auch der Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut und ihrem Haus vor. Anstatt schnell zu reagieren, setzte sie den Weg des Wegschauens und Ausblendens fort. Wie? Frau Dr. Hinz ließ sich, im Versuch Schadensbegrenzung zu betreiben, vom Geschäftsführer der Ingenieurkammer eine Haftungsfreistellung des Landes geben, obwohl diese finanziell nicht in der Lage war das Projekt zu stemmen. Als Rechtsaufsicht über die Kammer hätte das Wirtschaftsministerium dies nicht tun dürfen!
Auch eine rechtliche Prüfung wurde trotz deutlicher Zeichen nicht in Angriff genommen. „Die dringend erforderliche Aufklärung der Frage, wer Vertragspartner der Expo Dubai LLC. ist, wurde über Monate bis nach dem Beschluss des Doppelhaushalts hinausgezögert. Der Landtag war somit zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Fehlbetragsfinanzierung über den Sachstand nicht vollständig informiert!“, resümiert die Obfrau der FDP/DVP Fraktion Gabriele Reich-Gutjahr.
Auch Kultusministerin Dr. Eisenmann und das Staatsministerium waren involviert
Die Untersuchung ergab zahlreiche Indizien dafür, dass Wirtschaftsministerium und CDU zwingend an dem Projekt festhalten wollten und Kultusministerin Dr. Eisenmann dafür gesorgt hat, dass alle Zweifel aus dem Weg geräumt werden! Die Ingenieurkammer hat die CDU über zahlreiche – offizielle wie auch inoffizielle – Kanäle, wie etwa den Stiefsohn Eisenmanns, lobbyiert. Am Ende haben sich CDU und insbesondere Ministerin Eisenmann in der Koalition durchgesetzt. Man hat sich also vor den Karren der Ingenieurkammer spannen lassen und ein eigentlich schon gescheitertes Projekt auf Steuerzahlerkosten gerettet.
Auch der Chef der Staatskanzlei Dr. Stegmann im Staatsministerium war bei der Umsetzung des Projekts engagiert. Weder er, noch Frau Dr. Eisenmann, wirkte auf eine professionelle Lösung des strauchelnden Projektes hin. Stattdessen schoss die Koalition noch im Herbst 2019 zusätzliche Millionen zu. Verantwortungsbewusste Wirtschaftspolitik sieht anders aus!
Unsere Feststellungen im Überblick
Organisationsstrukturen im Wirtschaftsministerium müssen verändert werden
Damit sich ein solches Missmanagement in Zukunft nicht wiederholt haben wir die Regierung in einem Entschließungsantrag aufgefordert ihre Baustellen schleunigst zu beheben.
Unsere Forderungen an die Landesregierung:
Unsere Ansprechpartner:
Mitarbeiter
Stephanie Herborn
Das neue Hochschulrecht – eine Novelle unter dem Eindruck von Corona
Nach fast zehn Jahren grüner Führung im Wissenschaftsministerium des Landes brachte die Landesregierung mit dem Gesetzesentwurf zur Änderung von Vorschriften des Landeshochschulgesetzes (Viertes Hochschuländerungsgesetz – 4 HRÄG) am 20.10.2020 ein buntes Sammelsurium hochschulrechtlicher Änderungen in den Landtag ein. Am Mittwoch, den 25.11.2020, befasste sich der Wissenschaftsausschuss des Landtags mit dem Entwurf in einer turbulenten Sitzung. Der folgende Blogbeitrag widmet sich den Streitpunkten des Gesetzesentwurfs, einzelnen bedenkenswerten Regelungen des Entwurfs sowie den Positionen der FDP/DVP-Fraktion.
Man kann wohl sagen, dass der von der Landesregierung eingebrachte Gesetzesentwurf mit einem bunten Strauß Blumen vergleichbar ist. Jede Blume steht hierbei für eines der unter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer angesammelten Probleme, die scheinbar noch eilig vor Ende der Legislaturperiode im März 2021 gelöst werden müssen. Anders als bei den Änderungen im Hochschulrecht im Juni 2020 handelt es sich bei den aktuellen Vorschlägen der Landesregierung nicht nur um punktuelle Änderungen. Vielmehr werden durch die Novelle weite Teile des Hochschulgesetzes, sowie darüber hinausreichende Regelungen abgeändert, ergänzt oder neubegründet – und zwar mit beträchtlichen Auswirkungen auf Forschung und Lehre. Zugegebenermaßen enthält der bunte Blumenstrauß an Anpassungen einige schöne Blüten, also erstrebenswerte Regelungen oder zumindest Ansätze. Zu nennen ist beispielsweise die von uns seit Jahren geforderte Einführung der optionalen Bauherreneigenschaft der Hochschulen, welche es den Hochschulen in der Zukunft erleichtern wird, Bauvorhaben zu realisieren. Bekanntlicherweise kann ein an sich schöner Strauß Blumen jedoch durch einzelne oder in diesem Fall sogar mehrere verwelkte Blüten sein schönes äußerliches Erscheinungsbild verlieren.
Ein Indiz für die hohe Zahl welker Blüten war bereits die Menge der Änderungsanträge der Regierungsfraktionen am eigenen Gesetzentwurf. Für die FDP/DVP-Fraktion ergaben sich in der Folge nicht nur aufgrund des Gesetzesentwurfes, sondern auch aufgrund der von der Regierungsfraktion gestellten Anträge viele Fragen und das Erfordernis, mit vier Änderungsanträge sowie einem Entschließungsantrag Nachbesserungen vorzunehmen.
Neue Regeln zum Tierschutz – mehr Fluch als Segen für die Hochschullehre
Eine verwelkte Blüte stellt definitiv die Erweiterung des Aufgabenkanons der Hochschulen um den Aspekt des Tierschutzes und die Einführung des neuen § 30a LHG dar. Mit dieser Regelung wird es den Hochschulen im Ergebnis verwehrt, Tiere an den Hochschulen für Lehrzwecke – und somit zumindest mittelbar auch für Forschungszwecke – zu verwenden. Die von der Landesregierung vorgesehene Regelung stellt aus unserer Sicht nicht nur einen erheblichen und unverhältnismäßigen Eingriff in die grundrechtlich geschützte Freiheit der Forschung und Lehre dar, sondern wird sich zukünftig auch negativ auf die Qualität der baden-württembergischen Hochschulausbildung und deren nationale und internationale Konkurrenzfähigkeit auswirken. Dass die Bedenken der Liberalen hierzu nicht unbegründet sind, ergibt sich aus der zahlreichen Kritik am Entwurf in der Expertenanhörung.
So stellt sich nicht nur die Universität Hohenheim, sondern auch die Landesrektorenkonferenz, sowie die Studiendekane der Biologischen Fachbereiche an den Universitäten ausdrücklich und fundiert gegen den Entwurf. Konsens der Experten ist, dass für die Studierenden direktes Anschauungsmaterial unerlässlich ist, um in der Zukunft Forschungen anstellen zu können, die wiederum dem Tierwohl dienen. Auf lange Sicht schadet der Entwurf daher vielmehr dem Tierwohl, als diesem geholfen wird. Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Verwendung von Tieren durch Hochschulen bereits heute weitgehenden Regularien unterliegt. Vor allem wird an den Hochschulen im Land bereits heute das 3R-Prinzip praktiziert. Demnach werden längst Tierversuche durch Alternativen ersetzt (replace), die Zahl der Versuchstiere begrenzt (reduce) und die Belastung der Tiere auf ein unerlässliches Maß verringert (refine).
Ein weiterer Malus des aktuellen Vorstoßes der Landesregierung: den Hochschulen werden für die Umstellung auf „Alternative Lehrmaterialien“ keinerlei finanzielle Mittel bereitgestellt. Gewollt ist demnach eine kurzfristige Nachhaltigkeit zum Nulltarif, was für uns insbesondere während den andauernden Belastungen auch der Hochschulhaushalte durch die Covid-19-Pandemie eine Farce darstellt. Hinsichtlich der Regelungen zum Tierwohl werden mittlerweile selbst innerhalb der Regierungsfraktionen kritische Stimmen laut. Längst war in den Medien zu lesen, dass die CDU die Neufassungen zum Tierschutz ebenfalls für zu weitgehend ansieht. Man hat dort wohl endlich die Risiken für den Hochschulstandort erkannt, will aber ganz offensichtlich an dieser Stelle den Koalitionsfrieden auf der Zielgeraden nicht noch riskieren. Wir haben mit einem zielgerichteten Änderungsantrag versucht, diese Gesetzesänderung zu verhindern (Änderungsantrag Drucksache 16/9310 zum Gesetzesentwurf Drucksache 16/9090).
Für die FDP-DVP Fraktion war klar und alternativlos:
Aus dem Gesetz zur offenen Kommunikation wird das Verschleierungsverbot
Mit dem neugefassten § 9 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes plant die Landesregierung, den Hochschulen die Möglichkeit an die Hand zu geben, eine Verhüllung des Gesichtes zu untersagen. Die Liberalen habe sich zu dieser Thematik in ihrem Gesetzesentwurf (Drucksache 16/896) aus dem Oktober 2016 bereits umfassend positioniert und ein umfangreicheres Verschleierungsverbot an den Hochschulen gefordert. Der aktuelle Vorstoß der Landesregierung fällt in die Kategorie „gut gemeint, aber schlecht gemacht“. Insbesondere schafft er keine klaren Regelungen und stattet die Hochschulen so beispielsweise mit der Möglichkeit aus, eine Verhüllung des Gesichtes „zur Erreichung des Ziels einer konkreten Lehrveranstaltung“ zu verbieten. Welche Situationen hiervon genau erfasst sein sollen bleibt unklar. Im Übrigen sind weitere Regelungen zum Verbot von Gesichtsverhüllungen von den Hochschulen durch Satzung zu regeln. Im Ergebnis wird den Hochschulen also der schwarze Peter zugeschoben, selbst die Regelungen zu treffen und mögliche juristische Zwistigkeiten zu verantworten. Die Landesregierung entzieht sich der Verantwortung, verwendet unbestimmte Rechtsbegriffe und überlässt den Hochschulen die Regelungen im Einzelfall. Dabei sollte klar sein, dass ein Verbot der Verschleierung nicht nur auf Gesetzes- sondern auch auf Einzelfallebene (entschieden durch die Hochschulen) unverhältnismäßig sein kann. Die Hochschulen werden daher wohl eher Zurückhaltung walten lassen.
Die Liberalen fordern daher:
Die Einführung von Online- Sitzungen von Hochschulgremien und Online-Prüfungen für die Studierenden, nicht nur während der Corona-Pandemie
Die Digitalisierung ist, genau wie die rechtssichere Gewährleistung von Online-Sitzungen und Online-Prüfungen, eine Herzensangelegenheit der Liberalen. Jedoch sind die Vorgehensweisen, durch die die vorliegenden Regelungen des § 10a (Online Sitzungen) und § 32a (Online-Prüfungen) in das Landeshochschulgesetz eingefügt werden sollen, sehr fragwürdig.
Im Juni dieses Jahres wurde eilig eine LHG-Novelle durch das Parlament gebracht, die die Handlungsfähigkeit der Hochschulgremien in Corona Zeiten sichern sollte. Regelungen zu Online-Sitzungen sollten von den Hochschulen in Form von Satzungen ausgefüllt werden. Bereits damals haben wir gerügt, dass hierdurch den Hochschulen abermals der schwarze Peter zugeschoben wird. Dies gilt insbesondere bei einen solch sensiblen Aspekt wie dem rechtssicheren Umgang mit Online-Sitzungen. Wenige Monate später ist nun auch die Landesregierung klüger und schafft einen Maßstab durch § 10a LHG mit konkrete Vorgaben. Wir hätten eine (weniger eingriffsintensive) Handreichung für die Hochschulen dieser Regelung ganz klar vorgezogen. Fragwürdig ist auch, wieso der sehr ausführliche und detailreiche Entwurf des § 10a LHG erst als Änderungsantrag der Regierungsfraktionen nicht mal 24 Stunden vor der beschlussfassenden Sitzung eingeführt wurde. Damit wurde aus der Politik des Gehörtwerdens eine Politik der Überrumpelung und die neue Regelung nicht zuletzt auch der Expertise der Verbände vorsätzlich entzogen.
Hinsichtlich der Einführung der Online-Prüfungen in § 32a LHG gilt Entsprechendes. Bereits in dem Antrag „Rechtssichere Durchführung von Prüfungen aufgrund der Corona Pandemie“ (Drucksache 16/8050) haben wir die Probleme herausgearbeitet und auch hier kritisiert, dass die Hochschulen bei der Durchführung der neuen und notwendigen Prüfungsform sich selbst überlassen und damit vom Landesgesetzgeber im Stich gelassen werden. Auch durch diese Neuregelungen wird anstelle einer weniger eingriffsintensiven Handreichung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung eilig das Hochschulrecht fortgeschrieben. Die Hochschulen, die ihre Regelungen für Online-Prüfungen im Rahmen ihrer Satzungsautonomie bereits fortgeschrieben hatten, müssen nun erneut nachbessern, weil sich nun Kollisionen mit der neuen Fassung des höherrangigen LHG ergeben können. Diese Probleme waren vorhersehbar und hätte bereits im Voraus gelöst werden müssen.
Die kritische Stimme des Landesdatenschutzbeauftragten
Zur Qualitätssicherung sollen an den Hochschulen nun auch „äußere Studienverlaufsdaten“ erhoben und verarbeitet werden. Erfasst sein sollen hiervon unter anderem die Daten ehemaliger Bewerber, die sich nicht an der betroffenen Hochschule eingeschrieben haben. Nicht nur nach Auffassung des Landesdatenschutzbeauftragten, sondern auch nach dem Verständnis der Liberalen, sind die angepeilten Regelungen mit den gesetzlich geltenden Regelungen der DSGVO nicht vereinbar. Zunächst ist zu kritisieren, dass sich die Regelung erneut lediglich mit unbestimmten Rechtsbegriffen begnügt. Was „äußere Studienverlaufsdaten“ genau sein sollen, bleibt hierbei unklar. Ferner sind die betroffenen Daten nach der Beziehung der Hochschule grundsätzlich zu löschen. Die Erhebung der Daten der Betroffenen wird von der Landesregierung als „akzeptiert“ hingenommen, sofern die betroffene Person nicht widerspricht. Eine solche Widerspruchslösung entspricht nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen der DSGVO. Vielmehr bedarf es eigentlich einer datenschutzrechtlichen Einwilligung der Betroffenen
Daher fordert die FDP-DVP Fraktion:
Die wirkliche Verbesserung der Rolle und des Status der Lehrbeauftragten steht weiterhin aus
In der Vergangenheit waren Lehrbeauftragte hochschulrechtlich der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter zugeordnet. Der Gesetzesentwurf ordnet sie nun der Gruppe der „akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ zu. Grundsätzlich ist dies ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man die Interessenlagen im Blick hat. Es bleiben aber Zweifel, ob dies zu einer Verbesserung der Situation der Lehrbeauftragten – insbesondere an Musik- und Kunsthochschulen – führen wird. In Form eines Entschließungsantrags haben wir uns daher für die Stärkung der Rechte der Lehrbeauftragten eingesetzt, die schließlich einen beträchtlichen Teil der Lehre übernehmen und auch in der Corona-Krise besonders gefordert waren.
Fazit
Aufgrund der doch beachtlichen Risiken, welche die aktuelle LHG-Novelle für die Hochschulen mit sich bringt, konnten die Liberalen dem Gesetzesentwurf der Landesregierung nicht zustimmen. Neben teils schwerwiegenden Eingriffen in die Freiheit von Forschung und Lehre (bspw. Tierwohl) würden die Hochschulen Konstellationen mit erheblicher Rechtsunsicherheit (bspw. Datenschutz, Online-Sitzungen und Online-Prüfungen) ausgesetzt werden. Solche Konsequenzen, die sich nachteilig auf die Qualität der baden-württembergischen Hochschulausbildung auswirken, können wir insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie nicht hinnehmen. Die Hochschulen sind durch die aktuelle Situation bereits hinreichend belastet und sollten nicht noch weiteren Restriktionen ausgesetzt werden, die ihnen mehr schaden als dienen.
Gesund bleiben, auch wirtschaftlich – Liberale Alternativen zur Corona-Politik der Landesregierung
In der Aussprache in der Sondersitzung des Landtags zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zu den Corona-Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz unterstrich der Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, dass es gut sei, diese Debatte zu führen. Es müsse zugleich aber der Anspruch dieses Parlaments sein und bleiben, nicht nur informiert zu werden und zu debattieren, sondern auch zu entscheiden. Grundrechtseinschränkungen seien schließlich Sache des Parlaments und nicht die eines in der Verfassung nicht vorgesehenen Gremiums wie der Ministerpräsidentenkonferenz, die sich verhalte wie ein orientalischer Basar.
„Die Lage ist nach wie vor ernst“, so Rülke. Es drohe die Überlastung des Gesundheitswesens. Der sogenannte “Wellenbrecher-Lockdown” erweise sich aber – wie von der FDP vorausgesagt – als Rohrkrepierer, weil die Maßnahmen nicht zielgerichtet seien.
“Sie weichen aber nicht ab von Ihrer Schrotflintenpolitik nach der Methode: Man schießt ins Blaue und hofft damit, irgendwie Infektionsherde zu treffen.”
Dr. Hans-Ulrich Rülke
Er führte dazu die Äußerungen des Virologen Jonas Schmidt-Charasit an, nach denen pauschale Maßnahmen zur Kontaktreduktion nicht angemessen seien und es immer zu fragen sei, wie die Hygienekonzepte Betroffener aussähen und ob Infektionsherde nachgewiesen werden könnten. „Das gilt insbesondere für die Lieblingsgegner der Ministerpräsidenten: Gastronomie, Sport und Kultur!“
Unsere Forderungen
Die Leitlinien der Corona-Politik sollen nach dem Willen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin immer mehr im Wege der Ministerpräsidentenkonferenzen bestimmt werden. Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz erfolgte am 28. Oktober. Die nächsten fanden am 16. November und nunmehr am 25. November statt. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin verfügen zwar über die Richtlinienkompetenz. Die finale Entscheidung über die konkreten Maßnahmen und die langfristige Strategie zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie muss aber den Parlamenten obliegen. Dies erfordert eine ergebnisoffene Beratung, die selbstverständlich auch beinhaltet, einzelne Punkte oder gesamte Beschlussvorlagen der Ministerpräsidentenkonferenz durch das Parlament abzulehnen. Dies ist das Grundprinzip demokratischer Gewaltenteilung.
Vor diesem Hintergrund bestehen generelle Zweifel über die Geeignetheit und Erforderlichkeit von weiteren Verschärfungen der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.
Effektiver Gesundheitsschutz
Die verschärfte Corona-Lage in Baden-Württemberg erfordert eine effektive und effiziente Virusbekämpfung. Für diese ist eine breite gesellschaftliche Akzeptanz die entscheidende Voraussetzung, denn getroffene Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung können nur so wirksam sein, wie sie auch umgesetzt werden. Aktionistische Symbolmaßnahmen haben hierbei geschadet und sollten zukünftig vermieden werden. Das aktuell rasch voranschreitende Infektionsgeschehen macht ein effektives und effizientes Vorgehen zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 erforderlich. Die derzeit von der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen erscheinen jedoch vielfach mehr öffentlichkeitswirksam als wirksam im Kampf gegen das Virus.
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, Maßnahmen für einen effektiven Gesundheitsschutz und echten Schutz von Risikogruppen zu treffen, und hierfür
Kinder, Schule, Hochschule und Sport
Flächendeckende Einschränkungen beim Präsenzunterricht lehnt die FDP/DVP Fraktion strikt ab, da davon nicht nur das Recht der Kinder auf Bildung betroffen wäre, sondern auch die Eltern erneut in der Betreuung gebunden würden. Viele Eltern und Familien würden wieder einmal einer Zerreißprobe zwischen Kinderbetreuung und Berufstätigkeit ausgesetzt. Der Wirtschaft würde Arbeitskraft entzogen, und sie würde weiter einem erneuten Lockdown zugetrieben. Wir fordern deshalb erneut die Abgabe einer Bildungs- und Betreuungsgarantie, wie sie der nordrhein-westfälische Familienminister bereits vorgenommen hat. Sie soll sicherstellen, dass auch bei steigenden Infektionszahlen eine flächendeckende Schließung von Schulen und Kindertagesbetreuung nicht mehr vollzogen wird.
Eine Maskenpflicht für Grundschüler widerspricht allen bislang bekannten Studienergebnissen, wonach es Hinweise darauf gibt, dass Kinder unter 12 Jahren keine Treiber im Infektionsgeschehen sind. Eine Maskenpflicht wäre nach Auffassung der FDP/DVP Fraktion nur zu rechtfertigen, wenn nachgewiesenermaßen das Gegenteil der Fall wäre.
Wem es ernst ist damit, dass Unterricht auch unter Pandemiebedingungen stattfinden kann, der darf nicht aus Kostengründen notwendige Investitionen unterlassen. Es ist unverständlich, dass das Kultusministerium keinen Sinn in einer flächendeckenden Ausrüstung von Schulen mit Luftfiltern sieht. Nordrhein-Westfalen dagegen stellt 50 Millionen Euro zur Verfügung, um bei Bedarf Luftfilter anzuschaffen. Im Rahmen ihrer zur Verfügung gestellten Budgets haben die Schulträger zwar auch in Baden-Württemberg die Möglichkeit erhalten, auch Luftfilter zu finanzieren. Angesichts der Dringlichkeit des Handelns in diesem Zusammenhang fordern wir die Landesregierung auf, den Einsatz von Luftfiltern gezielt zu fördern. Zudem sind weitere umfangreiche Schutzmaßnahmen an den Schulen notwendig. FFP2-Schutzmasken müssen für alle Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen sowie als Angebot für die Lehrkräfte an Grundschulen zur Verfügung gestellt werden.
Außerdem fordern wir, dass den Schulen in dieser Situation die Einstellung von Assistenzlehrkräften ermöglicht wird, die Schulleitungen mehr Leitungszeit und Entlastung von Verwaltungsaufgaben erhalten; Letzteres wollen wir im Interesse eines funktionierenden Beratungs- und Unterstützungssystems auch für die Schulpsychologen erreichen. Und schließlich fordern wir eine beschleunigte Digitalisierung der Schulen, damit digitaler Unterricht und Unterricht in Hybridform jederzeit ohne Einschränkungen möglich ist.
Im Bereich des Sports gilt es aus Sicht der FDP/DVP Fraktion, die Schließung des Freizeit- und Amateursportbetriebs jenseits des Individualsports auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Ziel muss ein differenziertes Konzept sein, das Freizeit- und Amateursport vor allem auch für Kinder und Jugendliche unter klaren Hygienevorgaben weiterhin ermöglicht – in Berlin beispielsweise ist Sport im Freien in festen Gruppen bis 12 Jahren möglich.
Außerdem fordern wir eine Nachbesserung bei den Vorgaben der Landesregierung für die Nutzung von Tennishallen und Reithallen zu prüfen – Tennishallen dürfen bislang nur von maximal zwei Personen genutzt werden, auch wenn mehrere Plätze vorhanden sind.
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, die Bedürfnisse der Kinder, der Schulen, der Hochschulen und des Breitensports angemessen zu berücksichtigen, und dabei
Digitalisierung
Digitale Anwendungen in den Gesundheitsämtern und bei den Bürgerinnen und Bürgern können bei der Bekämpfung der Pandemie und der Kontaktnachverfolgung von großer Unterstützung sein. Wichtig dabei ist, dass die digitalen Werkzeuge auch flächendeckend zur Anwendung kommen. Unter anderem kann die Corona-Warn-App hier unterstützend wirken. Hier kann eine sinnvolle Weiterentwicklung die Nutzung der App in der Bevölkerung noch weiter vorantreiben. Wichtig dabei ist, dass die bestehenden Datenschutzrichtlinien weiterhin eingehalten werden, damit die Akzeptanz der App bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht schwindet.
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, der Covid-19 Pandemie mit den Mitteln der Digitalisierung begegnen und
Geschlossene Geschäftsbereiche, Kunst und Kultur
Die Schließungsanordnung für die Gastronomie sowie das Verbot touristischer Reisen stellt im Verhältnis zu den Erkenntnissen über die Orte, an denen sich Menschen mit dem Corona-Virus infizieren, einen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Laut einer Statistik des Sozialministeriums sind diese Betriebe gerade einmal zu vier Prozent an den bekannten Infektionen beteiligt, und wie aus der Presseberichterstattung der vergangenen Monate zu entnehmen war, sind Infektionen häufig bei großen privaten Feiern entstanden.
Die Geschäfte des Einzelhandels haben sich nachweislich nicht als Infektionsherde erwiesen. Die derzeit bereits vorhandene Regelung (10 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde) ist daher bereits ausreichend und eine weitere Verschärfung nicht notwendig. Diese würde nur den Geschäften schaden, hätte aber keine Wirkung bei der Bekämpfung der Pandemie.
Die vorgesehene Differenzierung zwischen Geschäften mit weniger und mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist noch dazu nicht nachvollziehbar und schwächt damit die Akzeptanz der Regeln. Es ist nicht verständlich, wieso bei größeren Geschäften ein stärkeres Ansteckungsrisiko vorhanden sein sollte als bei kleineren Geschäften, welches eine solche Verschärfung rechtfertigen würde.
Die Hotel- und Gastronomiebranche hat seit März große Anstrengungen unternommen, um sich für eine zweite Welle der Corona-Infektionen zu wappnen und die Infektionsrisiken zu minieren – um werden nun damit konfrontiert, dass sie trotzdem durch die Landesregierung in eine Schließzeit geschickt wurden.
Gerichte haben dies kürzlich im Gegensatz zur letzten Schließungsandrohung für verhältnismäßig angesehen, da eine umfangreiche finanzielle Unterstützung angekündigt wurde. Diese lässt aber nun auf sich warten, immer mehr Details sind nicht zufriedenstellend geklärt und nun wird noch maximal von einer Abschlagszahlung im November gesprochen. Das ist viel zu wenig und dauert viel zu lange. Es müssen hier unkomplizierte und schnelle Regelungen her, wie sie den Betroffenen und den Gerichten versprochen wurden.
Dazu benötigen auch verbundene Betriebe mit geschlossenem Betriebsteil, wie z. B. Landgasthöfe mit Metzgereien oder Bäcker mit angeschlossenem Café, sowie sonstige indirekt von den Schließungen betroffene Betriebe Unterstützung, wenn deren normaler Umsatz mehr als 50%, aber weniger als 80% mit der geschlossenen Gastronomie oder Hotellerie beträgt. Zu letzteren gehören beispielsweise Brauereien. Gegebenenfalls kann man diese Hilfe auch entsprechend nach Umsatzverlustanteil quotieren.
Die jüngsten Einschränkungen sollen die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung signifikant reduzieren, während die Wirtschaft möglichst von Schließungen freibleibt. Die Einbeziehung der Kultur- und Veranstaltungsbranche in die Schließungsanordnung, die gewissermaßen impliziert, dass dort verzichtbare Kontakte geschaffen werden, verkennt die ökonomische Relevanz der kulturschaffenden Branche, die eben auch wirtschaftlich handelt.
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, den pauschal geschlossenen Geschäftsbereichen sowie Kunst und Kultur wieder eine Perspektive zu geben und
Drucksache 16 / 9365 – Entschließungsantrag der FDP/DVP-Fraktion
Abgeordnete
Jochen Haußmann
Mitarbeiter
Benjamin Haak
Stephanie Herborn
Sven Jacobs
Marc Juric
Jana Lux
Thilo Weber
Sarah Wehinger
Erschließungsbeiträge – Wir fordern Verlässlichkeit und Planungssicherheit für Grundstücksbesitzer!
Das Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg soll im November und Dezember 2020 reformiert werden. Einer der Kernpunkte der Novelle ist eine Neuregelung der Erschließungsbeitragserhebung für kommunale Straßen. Wir bei der FDP/DVP fordern hier Verlässlichkeit und Planungssicherheit für Grundstücksbesitzer: Es muss eine echte Verjährungsregelung beschlossen werden und jahrzehntelange rückwirkende Erhebungen von Beiträgen für Bestandsstraßen muss ausgeschlossen werden!
Hintergrund: Was sind Erschließungsbeiträge und warum sind sie ein Problem?
Erschließungsbeiträge sind die Umlage der Kosten für den Bau von kommunalen Straßen auf die Anlieger. In Baden-Württemberg hat diese zwingend zu erfolgen und es besteht keine Möglichkeit für die Kommunen, auf die Erhebung zu verzichten. In der Praxis bedeutet dies ganz konkret, dass die Anlieger, sobald eine Straße fertig gebaut ist, von der Gemeinde eine Rechnung bekommen und Beiträge bezahlen müssen. Dies können durchaus mal mehrere zehntausend Euro sein.
In der tagtäglichen Praxis in Baden-Württemberg lassen sich dabei zwei typische Fallkonstellationen unterscheiden:
Erschließungsbeiträge für Neubaustraßen
Dies sind Beiträge für Straßen, die kürzlich komplett neu angelegt wurden, bspw. in Neubaugebieten, und deren Erhebung sehr häufig mit dem ersten Grundstücksverkauf erfolgt. Die Beiträge werden erwartet und sind vorhersehbar und meist sind dies klare Fälle.
Erschließungsbeiträge für Bestandsstraßen
Es kommt hingegen auch zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Bestandsstraßen, d.h. für Straßen, die seit vielen Jahren und häufig gar Jahrzehnten baulich (nahezu) fertiggestellt sind und für den Verkehr freigegeben sind. Die Anwohner rechnen nicht mehr mit und wissen nichts von Erschließungsbeiträgen und werden dann aus heiterem Himmel mit Gebührenbescheiden von mehreren 10.000 Euro konfrontiert.
Wie kann es aber nun zu einer Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Bestandsstraßen kommen? Hintergrund davon ist, wann eine Straße im formal-juristischen Sinne als „erstmalig endgültig technisch hergestellt“ ist – diese Herstellung ist nämlich eine Voraussetzung, damit eine Gebührenerhebung erfolgen kann. Wenn dies noch nicht erfolgt ist, kann auch keine Gebührenerhebung stattfinden.
„Endgültige Herstellung“ bedeutet, dass der tatsächliche Ausbauzustand der Straße dem geplanten Ausbauzustand (bspw. in Bauplänen) entspricht. Nur wenn dies gegeben ist, ist auch eine technische Herstellung gegeben. Wenn aber beispielsweise eine Straße nicht so breit ist wie im Bauplan vorgesehen, noch eine Straßenbeleuchtung vorgesehen ist oder ein Gehweg noch gebaut werden muss, ist auch die Straße noch nicht „technisch fertiggestellt“. Wenn eine Straße gar ohne Bauplan (wie es nach dem Krieg öfters vorkam) gebaut wurde, ist eine Herstellung im formellen Sinne überhaupt (noch) nicht möglich.
Es kann also zu der Situation kommen, dass eine Straße gebaut wurde, für den Verkehr freigegeben wurde und seit vielen Jahrzehnten in Benutzung ist, ohne dass sie im formellen Sinne „technisch hergestellt“ wurde. Daher kann es dann noch nach Jahrzehnten zu einer Erhebung von Beiträgen kommen, wenn bspw. der noch fehlende Gehweg angelegt wurde und damit die Herstellung erfolgt. Es kann auch vorkommen, dass Straßen grundsaniert werden, und alle Kosten dann auf die Anleger umgelegt werden. Da formal die Straße nie fertiggestellt war, ist dies immer noch eine “erstmalige Erschließung” und damit müssen die anliegenden Grundstücksbesitzer an den Kosten beteiligt werden.
Diese Situation führt in sehr vielen Gemeinden in Baden-Württemberg zu Unruhe und Unverständnis. Zu Recht beklagen Grundstücksbesitzer die fehlende Vorhersehbarkeit und Planbarkeit.
Beispiele für lokale Diskussionen und Proteste rund um das Thema Erschließungsbeiträge:
- Mühlacker: Streit wegen Ausbau der Enzberger Höhenstraße
- Horb am Neckar: Erschließungsbeiträge: Anwalt kritisiert Praxis
- Albstadt: Anwohner sollen 180.000 für Bordstein zahlen
- Kernen: Nach Jahrzehnten werden Anwohner zur Kasse gebeten
- Esslingen: Stadt und Anwohner streiten um Bezahlung von Erschließungsbeiträge
Wie groß das Problem in Baden-Württemberg insgesamt ist, ist uns nicht bekannt. Uns liegen jedoch Zahlen für eine Stadt mit ca. 25.000 Einwohnern vor. Diese hat insgesamt 680 beitragsrechtliche Straßen und Straßenabschnitte. Davon sind 454 verbindlich als nicht mehr beitragspflichtig fertiggestellt, bei ca. 170 steht die Fertigstellung noch aus und bei 50-60 Straßen ist die Situation noch ungeklärt. Es ist davon auszugehen, dass in vielen anderen Kommunen in Baden-Württemberg eine ähnliche Situation anzutreffen ist.
Die FDP/DVP-Fraktion hat sich in den letzten fünf Jahren in insgesamt vier Berichtsanträgen damit auseinandergesetzt:
- Kleine Anfrage des Abg. Dr. Ulrich Goll: „Position der Landesregierung zur rückwirkenden Erhebung von Kommunalabgaben, die auf Jahrzehnte zurückliegende Sachverhalte Bezug nimmt“; Drucksache 15/6940 (Juni 2015)
- Antrag der Abg. Gabriele Reich-Gutjahr: „Erschließungsbeiträge in Baden-Württemberg“; Drucksache 16/6417 (Juni 2019)
- Kleine Anfrage des Abg. Dr. Erik Schweickert: „Geltungsbereich der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) und Höhe der Erschließungskosten“, Drucksache 16/7783 (Februar 2020)
- Antrag der Abg. Dr. Erik Schweickert: „Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Straßen“, Drucksache 16/8700 (August 2020)
Wieso spielen Erschließungsbeiträge aktuell eine Rolle?
Am 11. November 2020 hat das Plenum des Landtags von Baden-Württemberg eine Novelle des Kommunalabgabengesetzes (KAG) debattiert. Das KAG regelt die Erhebung von Beiträgen durch die Kommunen und damit auch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Die aktuelle Novelle sieht eine Änderung vor. In §20 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt. Darin heißt es:
„Die Festsetzung eines Beitrags ist ohne Rücksicht auf die Entstehung der Beitragsschuld spätestens 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vorteilslage eintrat, nicht mehr zulässig.“
Damit möchte die Landesregierung einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nachkommen. Dieses hatte eine solche Verjährungsfrist gefordert, damit soll dem Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit nachgekommen werden.
Was heißt diese Regelung nun aber in der Praxis? In der Rechtsprechung sowie in der Begründung des Kommunalabgabengesetzes heißt es dazu:
„Im Erschließungsbeitragsrecht kommt es für die Bestimmung des Eintritts der Vorteilslage maßgeblich darauf an, ob eine beitragsfähige Erschließungsanlage technisch entsprechend dem (Aus-)Bauprogramm der Gemeinde vollständig und endgültig hergestellt ist“
Die bedeutet also, dass eine zwingende Voraussetzung für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach wie vor die vollständige, endgültige technische Herstellung einer Straße ist. Erst wenn dies der Fall ist, können Beiträge erhoben werden, und erst dann beginnt die Verjährungsfrist zu laufen.
Dies wird darauf hinauslaufen, dass sich in der Praxis der Erschließungsbeiträge überhaupt rein gar nichts ändert. Erschließungsbeiträge für Bestandsstraßen werden nach wie vor möglich sein, diese Altfälle werden durch die KAG-Novelle nicht gelöst werden. Die Verjährung dürfte nur in den allerwenigsten Fällen greifen und so gut wie gar keine Wirkung entfalten.
Was ist die FDP/DVP-Position dazu?
Rede Prof. Dr. Erik Schweickert
Grundsätzlich halten wir das System der Erschließungsbeiträge für richtig. Wenn ein Grundstück durch eine Straße erschlossen wird, soll der Grundstücksbesitzer für diesen Vorteil seinen Beitrag leisten und die Kosten sollen umgelegt werden. Wichtig ist, dass dies vorhersehbar und planbar ist. In Neubaugebieten ist dies aber überhaupt kein Problem und die Praxis hat sich bewährt.
Problematisch sehen wir hier die sogenannten Altfälle, wo Erschließungsbeiträge für Bestandsstraßen erhoben werden. Grundstücksbesitzer werden aus heiterem Himmel mit teilweise enormen Forderungen konfrontiert. Vorhersehbarkeit und Planbarkeit sind nicht gegeben. Ein neuer Vorteil entsteht auch nicht, da die Straße ja schon vorhanden ist. Die Erhebung liegt viel mehr im Spielraum der Gemeinde, da diese entscheidet ob und wann eine Straße doch nochmal technisch fertig gestellt wird oder nicht. Die Kriterien dazu sind vollkommen unklar.
Wir fordern eine Lösung, die diese Altfälle wirklich aus der Welt schafft und den Kommunen es erlaubt, von neuer Grundlage aus das Thema Erschließungsbeiträge neu anzugehen. Dazu muss es eine echte Verjährung geben, die es erlaubt, diese Altfälle aus der Welt zu schaffen und ein jahrzehntelange rückwirkende Erhebung von Beiträgen für Bestandsstraßen ausschließt. Dies haben wir in der Plenarsitzung am 2. Dezember 2020 durch einen Entschlussantrag gemeinsam mit der SPD-Fraktion und durch den Redebeitrag unseres Abgeordneten Prof. Dr. Erik Schweickert deutlich gemacht. Leider hat die Mehrheit von Grünen und CDU unseren Antrag abgelehnt. Innenminister Strobl hielt es nicht einmal für notwendig, inhaltlich auf unsere Fragen einzugehen und die Politik der Landesregierung zu erklären. Es wird stur am Bezugspunkt „endgültige technische Herstellung“ als Beginn der Verjährungsfrist festgehalten. Wir fordern von der Landesregierung daher nach wie vor Korrekturen! Bei Erschließungsbeiträgen muss es eine echte Verjährung für Altfälle und damit Planungssicherheit für Grundstücksbesitzer geben.
Hier unser Entschließungsantrag zum Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes: Entschließungsantrag der FDP/DVP Fraktion
Unsere Ansprechpartner:
Klimaschutz – aber smart: Unsere liberalen Antworten auf die Klimakrise
Es braucht Tempo und Innovation!
Nicht zuletzt die „Fridays for Future“-Demonstrationen im letzten Jahr und die folgenden politischen Diskussionen und Beschlüsse bis hin zu sog. „Klimanotständen“ sowie Debatten über CO2-Beipreisung, Flugverbote und Klimasteuern haben das Thema Klimaschutz enorm ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt.
In der Tat hat sich niemals zuvor das Klima so rasant verändert wie heute. Seine Entwicklung kann nur sehr schwer vorausgesagt werden – Fakt ist für uns jedoch: der Mensch ist dabei zu einem entscheidenden Faktor geworden, der Natur und Umwelt verändert. Diese Veränderung bedeutet trotzt aller mit ihr einhergehenden Probleme aber auch eine herausragende Chance für eine Politik, die Klimaschutz durch technologischen Fortschritt und den Wohlstand einer innovativen, smarten und modernen Gesellschaft voranbringt.
Offenkundig ist dringender Handlungsbedarf in der Klimafrage: es braucht auf allen politischen Ebenen zügig probate Lösungen, um der bedrohlichen Entwicklung des Klimas entgegenzusteuern. Neben einem hohen, der Dringlichkeit der Klimafrage gegenüber sachgerechten Tempo bei der Ausarbeitung probater Lösungen sind dabei aber ein klarer Kopf und ein Blick für das vernünftig machbare und tatsächlich wirksame aber ebenso wichtig.
Wir Freie Demokraten unterstützen ausdrücklich die klimapolitischen Ziele der Pariser Klimakonferenz, die Erderwärmung auf maximal 2, besser 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, die daraus resultierenden Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes sind verbindlich. Schon vor 50 Jahren hat die FDP/ DVP Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg in Sachen Umweltschutz Pionierarbeit geleistet und gefordert, den Klimaschutz als Staatsziel in der Verfassung zu verankern.
Klimaschutz gibt es nicht umsonst. Weil wir aber nicht zwischen Wohlstand und Klimaschutz als Alternativen wählen wollen, gibt es für uns Freie Demokraten nur eine Lösung: größtmögliche Effizienz, also mehr Klimaschutz pro investiertem Euro. Ökologischer und ökonomischer Verstand müssen sich nicht ausschließen.
Wir Freie Demokraten setzen dabei auf Nachhaltigkeit durch Innovation und vernünftige Lösungen. Die Stärke Baden-Württembergs und Deutschlands liegt in der Entwicklung, Herstellung und dem Export von Technologien, die die Probleme und Herausforderungen der Zeit lösen. Mit diesem Fokus auf Technologie und Innovation können wir einen globalen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dabei unsere eigene Wirtschaft stärken. Debatten über Verbote, planwirtschaftlich anmutende Zielvorgaben oder die alleinige Hoffnung, dass in Berlin und Brüssel „endlich gehandelt“ wird bringen uns und das Klima nicht voran.
Unser Abgeordneter Daniel Karrais, der für die Klimapolitik unserer Fraktion zuständig ist: „Klimaschutz gelingt nur, wenn die Prinzipien der Subsidiarität, der Sozialen Marktwirtschaft und der Technologieoffenheit respektiert werden. Klimaschutz darf nicht zu einer zentralverwaltungswirtschaftlichen Klima-Planwirtschaft führen. Ernstzunehmende Politik im Dienste des Klimaschutzes sieht anders aus“.
Unser Abgeordneter Daniel Karrais, der für die Klimapolitik unserer Fraktion zuständig ist: „Klimaschutz gelingt nur, wenn die Prinzipien der Subsidiarität, der Sozialen Marktwirtschaft und der Technologieoffenheit respektiert werden. Klimaschutz darf nicht zu einer zentralverwaltungswirtschaftlichen Klima-Planwirtschaft führen. Ernstzunehmende Politik im Dienste des Klimaschutzes sieht anders aus“.
Smarter Klimaschutz statt Symbolpolitik: unsere Vorschläge
Unser Ansatz ist klar: wir wollen smarte, wirksame Maßnahmen statt Symbolpolitik und Verbotsdiskussionen. Wenn wir im Ländle Vorbild und Vorreiter beim Klimaschutz werden wollen, müssen wir Klimaschutz als Chance begreifen und nicht als Bedrohung. Dabei dürfen wir nicht nur bestimmte Technologien im Blick haben – wir müssen offen sein für neue Technologien. Niemand kann heute wissen, ob in Zukunft völlig neue wissenschaftliche Erkenntnisse die Neubewertung einer vielleicht heute unerwünschten Technologie erfordern. Leider stehen wir mit unserem Fokus auf Technologieoffenheit beim Klimaschutz im Landtag oft alleine da – ein gutes Beispiel ist die von den Grünen vorangetriebene, einseitige Fokussierung auf die Elektromobilität, die scheinbar – entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse – eine besonders klimafreundliche Antriebstechnologie sein soll. Die CDU trägt als Koalitionspartner diese Linie mit, auch bei den anderen Fraktionen gibt es wenig Widerstand gegen den Elektro-Fokus, der abertausende Arbeitsplätze in der Automobilindustrie im Land aufs Spiel setzen könnte. E-Fuels und Wasserstofftechnologie sind gute Beispiele für Antriebstechnologien, die mit viel Know-How und Hirnschmalz aus dem „Ländle“ zu mehr Effizienz und Umweltfreundlichkeit im Mobilitätssektor führen können. Durch erhöhte Effizienz können Ressourcen und Energie gespart, Emissionen reduziert und die Lebensqualität verbessert werden – nicht nur im Ländle oder in Deutschland, sondern weltweit.
1.CO2-Emissionen deckeln
Wir Freie Demokraten setzen auf den europäischen Emissionshandel, also darauf, dass Marktteilnehmer für ihren Treibhausgasausstoß Verschmutzungsrechte erwerben müssen. Jahrelang mussten wir uns anhören, das sei zwar eine nette Idee, funktioniere aber nicht, da der Preis zu billig sei. Unser Antrag im Landtag „Zukunftssichere Rahmenbedingungen für gesicherte Kraftwerksleistung“ hat aber gezeigt: Der Emissionshandel wirkt deutlich! Im Juni 2019 haben die konventionellen Kraftwerke in Deutschland ein ganzes Drittel weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch im Juni 2018. Grund dafür war das Überschreiten einer Preisgrenze im Emissionshandel, die bei ungefähr 25 Euro je Tonne CO2-Äquivalent liegt und dazu führt, dass Strom aus klimafreundlicheren Erdgaskraftwerken günstiger wird als Strom aus Stein- und Braunkohlekraftwerken. Auf diese Weise sank die Nettostromerzeugung aus Braunkohle um 38 Prozent und die Nettostromerzeugung aus Steinkohle um 41 Prozent. Kurzum: Der Kohleausstieg hat faktisch längst begonnen – rein marktwirtschaftlich und ganz ohne bürokratisches Kohleausstiegsgesetz oder milliardenschwere Entschädigungen.
Wir Freie Demokraten wollen diese marktwirtschaftliche und effiziente Form des Klimaschutzes ausweiten. Anstatt den Autobauern weiterhin flottenbezogene Obergrenzen vorzugeben oder Ölheizungen zu verbieten, müssen Kraft- und Brennstoffe endlich in den Emissionshandel einbezogen werden. Im Gegensatz zur Einführung einer starren CO2-Steuer hätten die Bürgerinnen und Bürger beim Emissionshandel Zeit, sich anzupassen und beim nächsten Autokauf oder Heizungstausch die günstigste Lösung für ihren Alltag zu finden. Eine Steuer wird nur umgewälzt und landet in den Kassen des Staates. Steuereinnahmen sind nie zweckgebunden. Verfassungsrechtliche Bedenken bestärken unsere Kritik an der CO2-Steuer. Wir wollen, dass sich der Preis für Emissionszertifikate und damit für CO2 am Markt bildet. Wer in Klimaschutz investiert, braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Eine CO2-Steuer ist außerdem ein klimapolitisches Glücksspiel. Niemand kann den Klimawandel vorhersehen. Daher ist sie entweder unnötig hoch und belastet damit die Bürgerinnen und Bürger unverhältnismäßig oder sie ist zu niedrig und bringt dann nur wenig für den Klimaschutz.
War der Emissionshandel vor der Corona-Pandemie schon der günstigere und effektivere Weg, so ist er nach Corona geradezu zwingend. Denn die finanziellen Spielräume sind enger geworden. Die Bundesregierung aber hat sich noch vor der Pandemie für einen anderen Weg entschieden. Statt einer Zertifikatelösung hat sie einen nationalen CO2-Preis durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) festgesetzt, der wie eine Steuer wirkt. Dieser Weg ist aus unserer Sicht verfassungswidrig. Der Gesetzgeber ist nicht völlig frei darin, neue Steuern und Abgaben einfach zu erfinden. In Artikel 106 des Grundgesetzes sind die zulässigen Arten von Steuern aufgelistet. Der im BEHG enthaltene CO2-Preis wird Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen bereits in den ersten drei Jahren mit rund 25 Milliarden Euro belasten, ohne dass ein spürbarer Effekt für den Klimaschutz zu erwarten ist. Wer genug Geld hat, zahlt die Steuer ohne Verhaltensänderung. Und eine Politik, die die Mehrbelastung bei sozial Schwachen mit Ausgleichszahlungen kompensieren will, konterkariert ihre eigene Zielsetzung.
Wir Freie Demokraten sind der Meinung, dass Wettbewerb der beste Klimaschützer ist. Wirksam wäre die Ausweitung des EU-Emissionshandels auf den Verkehr und die Gebäude in Deutschland. Ein sektorenübergreifender Emissionshandel mit einem jährlich sinkenden Zertifikatevolumen schöpft das Potential der CO2 Reduzierungsmöglichkeiten optimal aus.
Wir wollen den Emissionshandel als globales Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und dafür nationale und internationale Kooperationspartner gewinnen. Das wird aber nur gelingen, wenn wir uns langfristig realistische Ziele setzen und auf unnötige Markteingriffe verzichten.
Klimaschutz braucht neue und intelligente Wege. Gerade Baden-Württemberg als das Land der Käpsele kann hier Lösungen entwickeln – und damit zu einem echten Vorbild und Vorreiter werden.
2. CO2 vermeiden und nutzen
Am besten ist es, ganz auf den Ausstoß von CO2 zu verzichten. Wenn das aber nicht geht, dann müssen wir ihn nutzen und CO2 sinnvoll einsetzen. Schon heute wird das industrielle „Abfallprodukt“ CO2 zum Beispiel in der Landwirtschaft verwendet, um Pflanzenwachstum zu beschleunigen oder als Rohstoff für chemische Produkte und künstliche Kraftstoffe. Kohlenstoff ist ein Baustoff für Vieles.
Für die Zukunft brauchen wir neue klimafreundliche Mobilitätsformen und einen attraktiven modernen Öffentlichen Nahverkehr.
Die einseitige Fokussierung auf die Elektromobilität ist hinsichtlich des Klimaschutzes kontraproduktiv, denn bei der CO2-Bilanz von Autos mit Batterieantrieb gibt es erhebliche Missverständnisse. Selbst bei einer Herstellung in Europa ist der Dieselmotor bei der PKW-Produktion laut einer vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) für den Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erstellten Studie noch viele Jahre die bessere Wahl. Betrachtet man die Bestandteile eines PKW vom Schmiersystem über Luftsystem, Elektronik, Motor, Getriebe bis hin zur Batterie, werden laut VDI bei einer Batteriefertigung in China 16,8 Tonnen CO2 in die Umwelt abgegeben, davon alleine 8,9 Tonnen bei der Batteriefertigung (48 kWh). Bei einem Auto mit modernem Dieselmotor sind es hingegen nur 8,4 Tonnen. Aber selbst bei einer Batteriefertigung in Europa würde die Produktion eines Elektroautos deutlich CO2-intensiver sein: Aktuell stehen 13,9 Tonnen zu Buche (davon 6 Tonnen Batteriefertigung). Außerdem wird die CO2-Bilanz von Elektroautos durch die offene Frage des Recyclings der Batterien belastet.
Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, auf der Basis von grünem Strom bieten enorme Chancen für die Zukunft der Mobilität. Dabei müssen wir nicht mal auf den Verbrennungsmotor verzichten. Der CO2-Ausstoß der Bestandsflotte kann durch E-Fuels sofort gesenkt werden. So könnten wir heute schon einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Für einen flächendeckenden Einsatz fehlen aber heute noch die gesetzlichen Grundlagen. Bundesumweltministerin Schulze blockiert zum Beispiel die Einführung des Kraftstoffs E25, bei dem bis zu ein Viertel des Benzins durch E-Fuels und Biokraftstoffe ersetzt werden soll. Dieses Verhalten schadet dem Klima.
Wasserstoff ist ebenfalls eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger bietet das bevorstehende weltweite Marktwachstum im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen auch enorme wirtschaftliche Potenziale für baden-württembergische Unternehmen. Denn anders als bei der Elektromobilität wird die gesamte Wertschöpfungskette von Wasserstoff und Brennstoffzellen bereits heute von über 90 Unternehmen und 18 Forschungseinrichtungen mit Standorten in Baden-Württemberg abgedeckt. Damit befindet sich im Ländle ein elementarer Anteil aller aktiver Unternehmen und Forschungsinstitutionen in Deutschland und Europa im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen. Der Standort Baden-Württemberg hat exzellente Voraussetzungen, um eine entscheidende nationale und internationale Rolle bei der Gestaltung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie einzunehmen. Um die Potenziale auszuschöpfen, brauche es jedoch die entsprechenden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, resümiert die Studie und sieht dabei insbesondere die Landesregierung in der Pflicht. Wir als FDP/DVP Fraktion pflichten dem bei, denn: Im Gegensatz zur Elektromobilität bietet die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie eine echte Zukunft für den Automobilstandort Baden-Württemberg und den damit verbundenen Wohlstand in unserem Land.
Die Potenziale von Wasserstoff sind groß, auch in Bereichen, in denen man dies zunächst nicht vermutet: wir Freie Demokraten wollen auch das Fliegen weder künstlich teurer machen oder sogar ganz verbieten. Warum nicht Flugzeuge in Zukunft mit Wasserstoff betreiben? Auch für Schiffe oder Lastwagen bietet Wasserstoff enorme Potenziale.
Nicht nur im Verkehr bietet Wasserstoff Vorzüge, sondern kann auch als Speicher- und Transportmedium eingesetzt werden. Auch in der Industrie ist grüner Wasserstoff ein Medium mit Zukunft. In der Industrie gibt es schon Lösungen aus Deutschland, um etwa in der Stahlproduktion mit Wasserstoff als Energieträger kein Kohlendioxid mehr auszustoßen. Beispielsweise Thyssenkrupp Steel verfolgt einen technologieoffenen Ansatz und setzt auf zwei Pfade: die Vermeidung von CO2 durch den Einsatz von Wasserstoff („Carbon Direct Avoidance“, CDA) sowie die Nutzung von anfallendem CO2 („Carbon Capture and Usage“, CCU). Dabei geht Thyssenkrupp schrittweise vor. Bis 2050 soll die Stahlproduktion bei Thyssenkrupp klimaneutral werden.
Durch die Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland ergibt sich außerdem ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial von bis zu 30 Milliarden Euro im Jahr 2050. Es könnten bis zu 800.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, wie einer aktuelle Studie des Wuppertal Instituts und DIW Econ zeigt. Ausgangspunkt für die Studie war die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die vor allem auf den Import setzt. Deutschland importiert grünen Wasserstoff, aber im Produktionsland fachen fossile Energieträger weiterhin den Klimawandel an. Auch besteht die Gefahr, dass wasserstoffnutzende Produktionszweige wie die Stahl- und Chemieindustrie zunehmend dahin abwandern, wo der Wasserstoff produziert wird.
3. CO2 speichern
Wenn CO2 weder vermieden noch genutzt werden kann, müssen wir es speichern, damit es nicht in die Atmosphäre gelangt. Auch durch die industrielle Speicherung kommen wir der Klimaneutralität näher, das zeigen erfolgreiche Pilotprojekte in Deutschland, Norwegen und den Niederlanden. So hat CCS (Carbon dioxide Capture und Storage), also die Abscheidung und Speicherung von CO2 in Pilotverfahren in Deutschland und beispielsweise auch in alten Ölquellen unter der Nordsee bewiesen, dass technisch und mit vertretbarem Risiko möglich ist, CO2 aus Abgasen abzuscheiden und dort, wo die geologischen Voraussetzungen dafür gegeben sind, unterirdisch zu lagern. Für die deutsche Industrie bietet sich die Chance, CO2 und damit sehr viel Geld einzusparen, schließlich ist CO2, das abgeschieden und gespeichert wird, ausdrücklich von der Zertifikatspflicht im EU-ETS befreit. Deutsche und europäische Unternehmen sind in diesem technologischen Bereich führend. Eine Finanzierung dieser modernen Abscheidungstechnik auf nationaler oder europäischer Ebene hätte einen wesentlich größeren Klimaschutz-Effekt als viele kleinteilige und höchst kostspielige Maßnahmen in Europa.
Doch es braucht nicht einmal Zukunftstechnologien. Unser Wald ist einer der größten Klimaschützer. Jeder Hektar Wald absorbiert im Jahresdurchschnitt 8 Tonnen CO2. Das entspricht nahezu dem durchschnittlichen CO2-Fußabdruck jedes deutschen Bürgers. Mit dem Ersatz fossiler, energieintensiver Rohstoffe durch nachwachsende Holzprodukte aus heimischen Wäldern kann der CO2-Ausstoß weiter gesenkt werden. So entsteht aus unseren nachhaltig bewirtschafteten Wäldern eine gesamte Klimaschutzleistung von jährlich 127 Mio. Tonnen CO2. Auch die Renaturierung von Mooren, die als natürliche Senken dienen, indem sie einen Teil des CO2 aus der Luft speichern, wollen wir nutzen und den Schutz von Moorflächen als CO₂-Senken und Biotope weiter vorantreiben.
Während die Speicherung von CO2 für Unternehmen durch die nicht benötigten ETS-Zertifikate einen finanziellen Anreiz bieten, wollen wir diesen auch für die biologische Speicherung und den Aufbau einer Kohlenstoffkreislaufwirtschaft schaffen: Wer künftig CO2 in irgendeiner Form bindet – sei es organisch oder in der Herstellung neuer Produkte (CCU) – sollte dafür aus Mitteln der Zertifikatserlöse vergütet werden. Beispielsweise bieten Land- und Forstwirtschaft wie kein anderer Wirtschaftsbereich die Chance, CO2 organisch zu binden. Dem Produkt Holz gelingt dies bei entsprechender Kaskadennutzung sogar über viele Jahre. Erfolgreiche Land- und Forstwirtschaft bedeuten deswegen einen aktiven Beitrag zu effizientem Klimaschutz.
4. Übergangstechnologien nutzen
Zu einer schnellen Reduzierung der Treibhausgase kann der Ersatz von Kohlestrom durch Gas einen enormen Beitrag leisten. Bei der Stromerzeugung durch Erdgas entsteht rund 60 Prozent weniger CO2, als bei Braunkohleverstromung. Während sich der Brennstoffausnutzungsgrad von Erdgas seit 1990 von 39 auf rund 60 Prozent verbessert hat, stieg er bei Kohle nur um 5 Prozent. Die Anlagen sind grundlastfähig und können problemlos in das bestehende Stromsystem integriert werden. Aufgrund schlechter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen stehen viele moderne Gaskraftwerke derzeit still.
Wir Freie Demokraten fordern deshalb die Regulierungsbedingungen so anzupassen, dass der wirtschaftliche Betrieb moderner Gaskraftwerke wieder möglich wird und Investitionen in neue Anlagen lohnen. Anlagen wie Speicher oder Power-to-X-Systeme, die die Stabilität des Stromnetzes verbessern, sollen nicht länger als Endverbraucher eingestuft werden und damit sofort von der Zahlung der EEG-Umlage befreit werden, um damit den Anreiz zu Investitionen für solche Einrichtungen zu erhöhen.
CO2 vermeiden, speichern und nutzen; Emissionen deckeln, Übergangstechnologien nutzen. Dies alles unter Einsatz des großen technologischen Know-Hows und der Innovationskraft baden-württembergischer Unternehmen, Tüftler und Ingenieure – das ist ein funktionierendes Rezept für mehr Klimaschutz. So können wir Arbeitsplätze in Schlüsselindustrien erhalten werden, die unseren Wohlstand in Baden-Württemberg sichern. So können wir regional einen wichtigen Beitrag zur globalen CO2-Reduktion leisten und dabei unserer Verantwortung als Land, das viel CO2 emittiert, optimal gerecht werden. Zudem können wir so die Energiewende effektiv, sozial gerecht und mit vertretbaren Kosten umsetzen. Smarter Klimaschutz: ein Erfolgsmodell.
Zahnloser Tiger statt wirksamer Maßnahme: das Klimaschutzgesetz der Landesregierung
Was hält die Landesregierung von diesem Erfolgsmodell? Leider nicht besonders viel. Stattdessen liefert sie mit ihrem „Klimaschutzgesetz“ ein leuchtendes Beispiel dafür, wie guter Klimaschutz nicht funktioniert. Kretschmanns Klimaschutzgesetz ist ein zahnloser Tiger – obwohl die Landesregierung im Klimaschutzgesetz ein Aushängeschild baden-württembergischer Politik sieht.
Die Verschärfung der Landesklimaziele über die Ziele des Bundes und der EU hinaus sind nicht durchdacht. Das Klima wirkt global. Ein Landesklimaschutzgesetz muss mindestens in den nationalen Kontext eingebettet werden.
Wichtige Bereiche, wie die Speicherung von Energie, der Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen oder die Einbeziehung des Waldes als natürliche CO2-Senke fehlen im Klimaschutzgesetz komplett. Stattdessen versteift sich die Regierung auf den Ausbau der Windkraft im windschwachen Baden-Württemberg und die Photovoltaik-Pflichten für Gebäudeeigentümer.
Unbestritten ist, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen. Mit dem engstirnigen Fokus der Landesregierung auf Sonne und Wind wird das aber nicht gelingen.
Die größte Baustelle hat die Landesverwaltung ohnehin bei sich selbst. Der Stand von energetischen Sanierungen, Photovoltaik und klimafreundlichen Heizungen bei Landesgebäuden ist mehr als beklagenswert.
Wenn es bei den Maßnahmen konkreter wird, hüllt sich die Landesregierung in langes Schweigen. Die Umsetzungsschritte im Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) fehlen seit Jahren.
Es hilft nichts, immer nur neue Maßnahmen und Ziele in der Theorie festzuschreiben. Es geht darum, mit einem eingesetzten Euro so viel Klimaschutz wie möglich zu erreichen. Wenn man diesen wichtigen Grundsatz nicht verfolgt, macht man die Klimawende so teuer, dass sie auf dem Weg am Widerstand der Bevölkerung scheitern wird.
Auch eine Strategie zur Klimaanpassung fehlt im Klimaschutzgesetz trotz der Dringlichkeit durch die aktuellen Extremwetterereignisse. Wir brauchen nicht nur Maßnahmen zur Verhinderung einer zu starken Erwärmung, sondern auch zur Linderung der Folgen der bereits stattfindenden Schäden. Dabei gibt es kein Patentrezept, da die Folgen des Klimawandels regional unterschiedlich ausfallen. Wir müssen technologieoffen bleiben und alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wir brauchen Frühwarnsysteme, leistungsfähigere Abwassersysteme oder Überflutungsflächen. Die Kommunen brauchen die notwendige Unterstützung für eine klimaresiliente Stadtentwicklung. Notwendig sind auch innovative Verfahren für die Böden und Pflanzen, die resistenter gegen extreme Wetterbedingungen sind. Vorausschauendes und vorsorgendes Handeln ist jetzt maßgeblich.
Einen Teil unserer Kritik hatten die Regierungsfraktionen aufgenommen und ihren Gesetzentwurf nachgebessert. Wichtige Themen fehlen aber immer noch. Wir forderten mit fünf Beschlussanträgen die Potenziale von Wasserstoff, CCUS-Technologien, des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft zum Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel sowie den Ausbau der Erneuerbaren Energien hin zu einem integrierten Energiesystem zu heben (Drucksachen Nr. 17/944-2, Nr. 17/944-3, Nr. 17/944-4, Nr. 17/944-5, Nr. 17/944-6).
Durch die Ablehnung unserer Forderungen, zwingt die Landesregierung die Menschen im Land aber lieber zu Verzicht und setzt mit dirigistischen Maßnahmen den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg aufs Spiel. Damit konterkariert sie letztlich den Klimaschutz. Wir haben aus diesen Gründen die Novelle des Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg am 6. Oktober 2021 abgelehnt.
Winfried Kretschmann hatte als erster grüner Ministerpräsident schon 2014 sein eigenes Klimaschutzgesetz mit mehr als 100 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ziel: Verringerung des CO2-Ausstoßes des Landes um 25 Prozent bis 2020. Dass der bisher eingeschlagene Weg der Landesregierung aber nicht funktioniert, zeigt sich auch darin, dass Baden-Württemberg die für Ende 2020 die angepeilten 25 Prozent an Reduktion, wenn überhaupt, nur mit Ach und Krach erreichen wird. Und selbst dann gelingt dies nur durch Schützenhilfe aus Berlin, das den CO2-Ausstoß bei Kohle und Gas mittlerweile bepreist und deshalb Kohlekraftwerke unwirtschaftlicher macht. Was wieder einmal mehr zeigt, dass die Kompetenzen für die Klimapolitik nicht beim Land, sondern beim Bund liegen. Selbst die Corona-Pandemie, während der Menschen zu Hause und Flugzeuge am Boden bleiben, hat die Situation bisher kaum entschärft.
2019 waren in Baden-Württemberg die CO2-Emissionen erst um 11,6 Prozent gesunken, das selbst gesteckte Ziel wäre also um mehr als die Hälfte verfehlt worden. In den Jahren 2015 und 2016 stiegen die Treibhausgasemissionen sogar weiter an.
Für uns steht fest: Klimaschutzgesetzgebung muss wirksame Maßnahmen beinhalten, Klimaschutz im Ländle muss mit innovativen Ideen und baden-württembergischer Technologie gestaltet werden – und er muss ökonomisch vernünftig, nicht ökologisch radikal sein. Klimaschutz ist das Ziel, Innovation ist der Weg. Wenn uns das gelingt, dann können wir die Chance nutzen, die Klimaschutz für den technologischen Fortschritt und die Sicherung des Wohlstands in unserem Land bedeutet. Gehen wir’s an: smart statt symbolpolitisch, innovativ statt ideologisch.
Aus Corona lernen, trotz Corona lernen: Nutzen wir die Pandemie für eine spürbare Verbesserung der Bildungspolitik im Land!
Jede Krise ist auch eine Chance – die Chance besteht darin, Fehler zu erkennen und diese zu beheben. Für uns Freie Demokraten gilt das auch im Hinblick auf die Corona-Krise, die einige Versäumnisse der Bildungspolitik der Landesregierung offenbar gemacht hat. Es ist Zeit, aus den Fehlern zu lernen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen!
Die Corona-Pandemie ist fraglos eine der größten Belastungsproben für das Bildungssystem in unserem Land. Während der flächendeckenden Schulschließungen im Frühjahr mussten sich Eltern, Lehrer und Schüler weitgehend unvorbereitet auf digital gestützten Unterricht umstellen. Der anschließende Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen ist auch eine große Herausforderung: Prüfungen gilt es trotz aller Belastungen zu bewältigen, Versäumtes aufzuholen, den Schulalltag unter großen Hygiene- und Abstandsvorschriften zu meistern. Dafür sind verlässliche Vorgaben mit praktischer Unterstützung für die unterschiedlichen Pandemiestufen erforderlich.
Wir Freie Demokraten treten für eine Bildungs- und Betreuungsgarantie ein, wie sie der nordrhein-westfälische FDP-Familienminister Dr. Joachim Stamp abgegeben hat. Die Eltern und Schüler müssen sicher sein können, dass ihnen kein weiterer kompletter Lockdown von Kinderbetreuung und Schulen mehr zugemutet wird. „Es macht in einer zugespitzten Entscheidungssituation einen gewichtigen Unterschied, ob eine Regierung nur die Rückkehr zum Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen beschlossen oder aber sich ausdrücklich verpflichtet hat, die Kindertagesbetreuung und die Schulen nicht zu schließen“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern.
Bei allen Belastungen werden aber auch Erfahrungen gewonnen, die nach unserer Überzeugung für die Weiterentwicklung des Bildungswesens nutzbar gemacht werden müssen. Dies gilt sowohl für die Krisenfestigkeit als auch für die Qualität des Bildungsangebots. Die Schließung der Schulen bedeutete für Lehrer, Eltern und Schüler beim Unterrichten und Lernen zu Hause in einer bisher ungekannten Weise auf sich gestellt zu sein. Gleichzeitig wurde noch einmal transparent, welche fundamentale Rolle die soziale Interaktion beim Lernen spielt. Das ungeplante Experiment hat gezeigt: Weder die Mitschüler noch der Lehrer sind ersetzbar. Das zeigte sich insbesondere dort, wo Eltern und Familien nicht in der Lage waren, einzuspringen und beim Lernprozess zu unterstützen. Daraus ergibt sich eine doppelte Aufgabenstellung: Einerseits gilt es, die Chance der Digitalisierung für die bestmögliche Entfaltung jedes Schülers zu nutzen, indem Lernprozesse stärker auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Andererseits gilt es, ein förderliches soziales Umfeld für jeden Schüler sicherzustellen.
Bei allen Belastungen werden aber auch Erfahrungen gewonnen, die nach unserer Überzeugung für die Weiterentwicklung des Bildungswesens nutzbar gemacht werden müssen. Dies gilt sowohl für die Krisenfestigkeit als auch für die Qualität des Bildungsangebots. Die Schließung der Schulen bedeutete für Lehrer, Eltern und Schüler beim Unterrichten und Lernen zu Hause in einer bisher ungekannten Weise auf sich gestellt zu sein. Gleichzeitig wurde noch einmal transparent, welche fundamentale Rolle die soziale Interaktion beim Lernen spielt. Das ungeplante Experiment hat gezeigt: Weder die Mitschüler noch der Lehrer sind ersetzbar. Das zeigte sich insbesondere dort, wo Eltern und Familien nicht in der Lage waren, einzuspringen und beim Lernprozess zu unterstützen. Daraus ergibt sich eine doppelte Aufgabenstellung: Einerseits gilt es, die Chance der Digitalisierung für die bestmögliche Entfaltung jedes Schülers zu nutzen, indem Lernprozesse stärker auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Andererseits gilt es, ein förderliches soziales Umfeld für jeden Schüler sicherzustellen.
Dies sind unsere Schlussfolgerungen und Lehren aus der Krise:
Auf die Lehrer kommt es an!
Zudem wären die Beseitigung des Fachlehrkräfte-Beförderungsstaus und ein Klassenteiler von 28 Schülern sinnvolle Instrumente. Ferner weist der Philologenverband zurecht darauf hin, dass in der Corona-Pandemie die Anforderungen an die Lehrkräfte in ihrer täglichen Arbeit erheblich gestiegen sind – insbesondere Verwaltungsaufgaben und Aufgaben im Bereich der Aufsicht und Betreuung der Schüler sind dazugekommen. Hier fordern wir die Kultusministerin auf, für Entlastung zu sorgen. Lehrerinnen und Lehrer sollten sich auf guten Unterricht konzentrieren können, statt wertvolle Zeit mit Nebenaufgaben zuzubringen. Die Einstellung von Verwaltungsassistenten und Systemadministratoren könnte eine echte Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte mit sich bringen. Es ist außerdem unverständlich, warum sich die Kultusministerin beharrlich weigert, in einer Situation wie der jetzigen die Beschäftigung von Assistenzlehrkräften zu ermöglichen, wie dies in Bayern praktiziert wird. Nach unserer Auffassung gilt es, die Lehrerinnen und Lehrer anspruchsvoll auszubilden. Die fundierte Ausbildung bildet einerseits die Grundlage für die hohe Verantwortung und die pädagogische Freiheit, die den Lehrerinnen und Lehrern übertragen wird und die es hochzuhalten gilt. Sie bildet andererseits auch die Grundlage für die sehr gute Leistung, die unsere Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich erbringen und die von jeder Lehrerin und jedem Lehrer eingefordert werden kann – und muss.
Nach unserer Auffassung gilt es, die Lehrerinnen und Lehrer anspruchsvoll auszubilden. Die fundierte Ausbildung bildet einerseits die Grundlage für die hohe Verantwortung und die pädagogische Freiheit, die den Lehrerinnen und Lehrern übertragen wird und die es hochzuhalten gilt. Sie bildet andererseits auch die Grundlage für die sehr gute Leistung, die unsere Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich erbringen und die von jeder Lehrerin und jedem Lehrer eingefordert werden kann – und muss.
Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrern neu entfalten!
Die aktuelle Erfahrung hat die elementare Bedeutung der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrern deutlich werden lassen. Für eine gelebte Bildungspartnerschaft zum Wohle aller Kinder und Jugendlichen bedarf es einer Kultur des intensiven Austauschs und der echten Zusammenarbeit. Für beide Seiten bedeutet dies Möglichkeiten und Pflichten zugleich. Neben kurzen Wegen der Kontaktaufnahme bedarf es fester Formen der Kontaktpflege beispielsweise in Form von verbindlichen Eltern-Lehrer-Gesprächen. Das gilt umso mehr, wenn Eltern mehr Mitverantwortung im Lernprozess ihrer Kinder übernehmen wollen. Formen dezentralen Lernens stehen wir grundsätzlich offen gegenüber, sofern sie unter staatlicher Schulaufsicht und in Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer stattfinden.
Möglichst viel Wahlfreiheit im Bildungsangebot schaffen!
Zwischen gebundenen und offenen Angeboten beim Ganztag wählen zu können, gehört ebenso dazu wie der Erhalt und die Stärkung der Haupt- und Werkrealschulen als „Berufliche Realschulen“, der Erhalt der Beruflichen Schulen in ihrer Vielfalt, der Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), die Stärkung der Realschulen und eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 sowie die Möglichkeit, eine Schule in freier Trägerschaft besuchen zu können. Mit parlamenatrischen Beiträgen zu mehr Wahlfreiheit in Debatten, Anfragen und Gesetzentwürfen, z.B. zur Aufnahme der offenen Ganztagsschule neben die gebundene Ganztagsschule ins Schulgesetz, verfolgen wir dieses Ziel mit Nachdruck. Leider stehen wir hiermit oftmals alleine da – so erinnert unser Bildungsexperte und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Timm Kern an das Abstimmungsverhalten der anderen demokratischen Parteien bei der Abstimmung über den FDP-Gesetzentwurf zur Wahlfreiheit beim Ganztag: „Für die Grünen ist Offenheit und Wahlfreiheit in diesem Politikbereich ideologisch ohnehin indiskutabel, die SPD die offene Ganztagsschule als ‚Bällebad‘ verunglimpft. Auch die CDU lehnte unseren Gesetzentwurf damals ab.“
Um die Bildung von Klassen auf möglichst einheitlichem Niveau zu schaffen, ist die Grundschulempfehlung wieder verbindlich auszugestalten. Hierbei schlagen wir ein Letztentscheidungsrecht der aufnehmenden Schule vor. Nach der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung nahmen die Sitzenbleiberquoten in Baden-Württemberg um mehr als das Doppelte an Gymnasium und um fast das Fünffache an Realschulen zu, Baden-Württemberg rutschte bereits vor der Corona-Krise in allen relevanten Bildungsrankings seit Abschaffung der Grundschulempfehlung empfindlich ab – zugunsten von Ländern wie Bayern, Sachsen und Thüringen, die an einem vielgliedrigen Schulsystem mit verbindlicher Grundschulempfehlung festhalten. „Die Kultusministerin sollte sich dieser Einsicht nicht länger verschließen. Die verbindliche Empfehlung erleichtert die Bildung von Klassen aus Schülern mit vergleichbaren Begabungen und Leistungsvoraussetzungen enorm“, so der Fraktionsvorsitzende Dr. Hans-Ulrich Rülke.
Schließlich sollen die Möglichkeiten jeder Schule verbessert werden, die Schüler individuell zu fördern. Dies betrifft einerseits die finanziellen Mittel und die Möglichkeiten, Assistenzlehrkräfte anzustellen. Andererseits soll eine Schule bei Personalknappheit vorübergehend von den allgemeinen Vorgaben zur Stundentafel abweichen können.
Mehr dazu in unseren Pressemitteilungen zum Thema:
Digitale Schule zügig umsetzen – und ins Gesetz aufnehmen!
Alle Schulen müssen endlich leistungsstarke und schnelle Internetanbindungen erhalten – schnelles Internet ist die Grundvoraussetzung für digital gestützten Unterricht.
Darüber hinaus braucht es eine langfristige Finanzierung der digitalen Infrastruktur, der Ausstattung von Schulen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern mit Hard- und Software. Nach Erkenntnissen des von FORSA im Auftrag der FDP-Bundestagfraktion in Auftrag erstellten „Digitalisierungsmonitors 2020“ geben 80% der Befragten an, dass die Schulen nicht ausreichend mit digitaler Infrastruktur ausgestattet sind – der Wert stieg im Vergleich der vergangenen Jahre stark an.
Von entscheidender Bedeutung ist auch die Wartung und Aktualisierung der Systeme durch IT-Systemadministratoren, die wir Freien Demokraten „Digitale Hausmeister“ nennen. Die kommunalen und freien Schulträger müssen hierfür endlich finanziell entsprechend ausgstattet werden. Es bedarf einer tragfähigen Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund, Land und Kommunen!
Auf Antrag ist unserem Vorschlag gemäß den Schulen ein Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung des Digitalbereichs zu geben. Dabei gilt es auch, die Chance einer sinnvollen Verzahnung von Schulbausanierung und -modernisierung einerseits und der Digitalisierung der Schulen andererseits zu nutzen. Ein Schulhaus auf Höhe der Zeit ist im Jahr 2021 nur ein solches, das auch technisch hohen Ansprüchen genügt.
Ferner brauchen wir ein Zulassungsverfahren für digitale Anwendungen, bei dem der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ein Vetorecht besitzt. So entsteht eine Positivliste von datenschutz- und datensicherheitskonformen Anwendungen, unter denen die Schulen auswählen können. Momentan ist die Landesregierung leider einseitig auf bestimmte Softwarelösungen wie Microsoft Office 365 fixiert. Dr. Timm Kern mahnt an: „Dass sich nun auch der Landeselternbeirat, die Arbeitsgemeinschaften gymnasialer Elternvertreter und der Philologenverband in Sorge um den Datenschutz an den Schulen zu Wort gemeldet haben, darf die Kultusministerin keinesfalls ignorieren. Die Kultusministerin muss sich von ihrer Fixierung auf das Microsoft-Produkt „Office 365“ lösen und den Datenschutzbeauftragten ergebnisoffen prüfen lassen, welche Anwendungen vorab definierten Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit an den Schulen entsprechen. Es handelt sich um eine entscheidende Weichenstellung: Alle am Schulleben Beteiligten müssen sich sicher sein können, dass beim digitalen Unterrichten und Lernen Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sind.“
Insgesamt muss die „Digitale Schule“ gesetzlich verankert werden. Dies wollen wir mit einem Gesetzentwurf sicherstellen, den unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Timm Kern am Mittwoch, den 11. November im Landtag eingebracht hat:
Ziel ist es, einen neuen § 48 a „Digitale Schule“ ins baden-württembergische Schulgesetz aufzunehmen. Dieser soll die Landesregierung verpflichten, die nötige digitale Infrastruktur und Ausstattung mit digitalen Endgeräten sowie deren Wartung durch einen Systemadministrator sicherzustellen. Zudem setzt er der Gesetzentwurf Leitplanken für den Erlass der angesprochenen Datenschutzrichtlinien und ordnet allen Schulen im Land ein Budget für die Veranstaltung von Fortbildungsformaten zur digitalen Bildung zu. Eine entsprechende Fortbildungspflicht im Bereich der digitalen Bildungwürde vor allem den Staat verpflichten, für ausreichend Lehreraus- und -fortbildungsangebote im Bereich der digitalen Bildung zu sorgen. Hierbei geht es darum, Lehrkräften aller Altersstufen wertvolle Medien- und Digitalkompetenz zu vermitteln und pädagogische Konzepte zu entwickeln, die eine gelingende Einbindung digitaler Geräte in Präsenzunterricht ermöglichen. Der Nachholbedarf ist offenkundig: 88 % der Befragten im „Digitalisierungsmonitor 2020“ gaben an, dass Lehrerinnen und Lehrer nur unzureichend oder gar schlecht auf digitalen Unterricht vorbereitet seien. Auch dieser Wert stieg im Vergleich der vergangenen Jahre erheblich an – und ist wohl auf die mitunter schlechten Erfahrungen im Homeschooling zurückzuführen, welches laut Digitalisierungsmonitor zu 68 % aus per E-Mail versendeten Hausaufgaben und zu 24 % aus im Schulhaus abzuholenden Papierausdrucken bestand.
Darüber hinaus sind Bund, Länder und Gemeinden aufgefordert, einen Digitalpakt 2.0 zu vereinbaren.
Digitale Bildung bedeutet auch mehr denn je, dass das Know-How über die Potenziale der Digitalisierung an die Schüler vermittelt wird. Das Fach Informatik – mit Inhalten weit über die Informationstechnik hinaus – ist daher an allen weiterführenden Schulen mindestens als Wahlpflichtfach einzurichten. Gleichzeitig brauchen wir eine möglichst früh einsetzende Medienbildung ab Klasse 1
Die Eigenverantwortung der Schulen stärken!
Die einzelnen Schulen sind bereits jetzt die zentralen Einheiten des Innovations- und Veränderungsprozesses. Wird das digitale Lernen ausgebaut, kommt der Schule als Dreh- und Angelpunkt und als zentralem sozialen Bezugspunkt eine umso größere Bedeutung zu. Wir wollen die Schulen deshalb in ihrer Eigenverantwortung stärken, konkret neben einem verlässlichen Budget und inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten mehr Möglichkeiten der Personalauswahl und -entwicklung geben. Die Schlüsselposition nehmen in diesem Prozess die Schulleiter ein. Gerade für einen gelingenden weiteren Ausbau des digitalen und dezentralen Lernens gilt es sicherzustellen, dass die Schulleiter mit ausreichend Kontroll- und Durchsetzungsmöglichkeiten ausgestattet sind. Auch und gerade die Schulleitungen gilt es von bürokratischen Sonderaufgaben zu entlasten, die sich während der Coronakrise vervielfältigt haben – insbesondere für Schulleitungen ist unser Vorstoß, Verwaltungsassistenten zur Abnahme von Verwaltungsaufgaben einzustellen, daher sinnvoll.
Im zentralen sozialen Bezugspunkt Schule darf ferner ein funktionierendes Unterstützungssystem aus Schulpsychologen, Schulsozialarbeitern und Beratungslehrern nicht fehlen. Die von Shutdowns und Einschränkungen charakterisierte Corona-Zeit mit ihren nicht hinweg zu diskutierenden, psychischen und sozialen Folgen für Schüler, Lehrer und Eltern hat den Bedarf hieran abermals verschärft. Land und Kommunen müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein entsprechend gut ausgebautes Angebot vor Ort gestaltet werden kann.
Gesundheitsschutz in der Schule sicherstellen!
Das oberste Gebot in Zeiten einer Pandemie ist weiterhin der Gesundheitsschutz. Es gilt, die Gesundheit von allen am Schulleben Beteiligten – Schüler, Lehrer und deren Familien – sicherzustellen. Ein Schulbesuch darf kein signifikant erhöhtes Gesundheitsrisiko bedeuten. Umfassende – aber auch tatsächlich sinnvolle und funktionale – Hygienekonzepte und Infektionsschutzauflagen sind der beste Garant dafür, dass ein Präsenzunterricht an baden-württembergischen Schulen verantwortungsvoll möglich ist und ein zweiter Total-Lockdown der Bildungseinrichtungen vermieden werden kann. Leider musste man in den letzten Monaten häufiger das Gefühl haben, dass die Infektionsschutzmaßnahmen im Schulbereich häufiger das Gefühl haben, dass es sich um Symbolpolitik denn tatsächlich sinnvolle Beiträge zu mehr Schutz handelt – beispielhaft erwähnt sei die kaum durchsetzbare Maskenpflicht für Schüler am Platz während des Unterrichts. Außerdem braucht es schlichtweg mehr Unterstützung bei der Umsetzung: „Zu Recht weist der Berufsschullehrerverband auf ein Missverhältnis zwischen der Anordnung weitreichende Infektionsschutzmaßnahmen einerseits und der mangelnden Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung andererseits hin“, so Dr. Timm Kern.
Regelmäßiges Lüften mit Frischluft, insbesondere bei den über die Wintermonate niedrigen Temperaturen, ist allein keine ausreichende Infektionsschutzmaßnahme. Zudem steigt die Erkältungsgefahr für Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen, wenn sie permanent der Kaltluft ausgesetzt sind. Wir fordern die Landesregierung daher auf, unverzüglich Mittel für die Installation von Luftfilteranlagen in Klassenzimmern und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bereitzustellen. Luftfilter, beispielsweise HEPA-Filter, sind geeignet, die Ansteckungsgefahr in Innenräumen signifikant zu vermindern – ganz ohne Frieren. Andere Länder, wie Nordrhein-Westfalen mit seiner liberalen Kultusministerin Yvonne Gebauer, haben die Potenziale von Luftfiltern schon länger erkannt. Ihre baden-württembergische Amtskollegin bleibt aber untätig und gewährt den Schulträgern keinerlei (Ko-)Finanzierungsperspektive für die kostspielige, aber sinnvolle Anschaffung von Luftfiltergeräten. Hier muss mehr kommen!
Zudem muss die Kultusministerin zeitnah FFP2-Schutzmasken für alle Lehrkräfte und zum nächstmöglichen Zeitpunkt auch für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen – im Unterschied zu einer Alltagsmaske aus Stoff schützen FFP2-Masken nämlich sowohl die Menschen in der Umgebung des Trägers, als auch den Träger selbst.
Ferner gilt es, die Kapazitäten für Schnelltests bei Risikogruppen in der Kinderbetreuung und in den Schulen auszuweiten. Auch bedarf es eines von der Landesregierung aufgestellten Stufenplans, anhand dessen klar wird, ab welchem Infektionsgeschehen vor Ort welche lokalen Maßnahmen für die Bildungseinrichtungen getroffen werden – die bisherige allgemeine Einteilung der Landesregierung in drei Pandemiestufen, von denen aktuell die dritte bereits erreicht ist, ist für diesen Zweck nicht ausreichend.
Zu guter Letzt erfordert Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen auch solche Räumlichkeiten, die ein Einhalten von Abstandsregeln ermöglichen. Oftmals reicht hier das Platzangebot im Schulhaus nicht aus, eine ganze Schulklasse mit je 1,5 m Abstand zwischen den Schülern unterzubringen. Das Kultusministerium muss die Schulträger daher engagiert dabei unterstützen, geeignete zusätzliche Räume für den Schulbetrieb zu erschließen.
„Es steht außer Frage, dass an dieser Stelle ein Kraftakt notwendig ist. Sowohl die Gesundheit von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften als auch das Recht junger Menschen auf Bildung müssen uns diesen Kraftakt wert sein“, resümiert der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Dr. Timm Kern.
Digitalisierung, Gesundheitsschutz, Wahlfreiheit, Eigenverantwortung und eine gelingende Entlastung der Lehrkräfte – in diesen Bereichen muss die Landesregierung nun während der zweiten, „heißen Phase“ der Corona-Pandemie dringend nachsitzen. Es gilt, die Erkenntnisse aus den vergangenen Monaten zu politischer Realität werden zu lassen – im Interesse aller Schüler, Lehrer und Eltern im Land. Mit unseren Vorschlägen werden wir Freien Demokraten uns im Landtag weiterhin dafür einsetzen, dass Frau Eisenmann ihre bildungspolitischen Versäumnisse der letzten Jahre korrigiert und Corona die Zukunftschancen der Schülerinnen und Schülern im Land nicht ausbremst.
Unser Ziel ist und bleibt: weltbeste Bildung in Baden-Württemberg! Mehr denn je muss unser Land daher in diesen Zeiten sein Bildungssystem so sanieren, dass es auf hohem Niveau krisenfest und zukunftssicher ist.
Jetzt zählt’s – wir bleiben dran!
Mit dem Digitalisierungsmonitor 2020 legt die FDP-Bundestagsfraktion zum dritten Mal die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zur Digitalisierung vor. Sie wurde wie schon in den Vorjahren vom Meinungsforschungsinstitut forsa durchgeführt und steht unter dem Eindruck der Corona-Pandemie.
Digitalisierungsmonitor der Bundestagsfraktion
Unsere Ansprechpartner:
Stringentes Gesamtkonzept statt zusammenhanglosem Aktionismus bei Corona-Verordnungen
Der FDP/DVP Fraktion ist es ein wichtiges Anliegen, dem Recht auf Bildung auch in einer Pandemie zur Durchsetzung zu verhelfen. Eine erneute flächendeckende Schließung von Kinderbetreuung und Schulen muss verhindert werden. Wir beantragen deshalb erneut, eine Bildungs- und Betreuungsgarantie abzugeben, wie dies der nordrhein-westfälische Familienminister Dr. Joachim Stamp bereits vorgenommen hat. Gleichzeitig besteht in Baden-Württemberg ein offensichtliches Missverhältnis zwischen der Anordnung weitreichende Infektionsschutzmaßnahmen einerseits und der mangelnden Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung andererseits. Bereits bei der Wiederöffnung der Schulen nach ihrer pandemiebedingten Schließung im Frühjahr ist auf die drohenden pandemiebedingten Personal- und Raumengpässe an den Schulen immer wieder hingewiesen worden. Die FDP/DVP Fraktion fordert damals wie heute die Kultusministerin auf, die Schulen und Schulträger bei der Suche und Erschließung von zusätzlichen Räumen für den Schulbetrieb zu unterstützen. Außerdem fordern wir, dass den Schulen in dieser Situation die Einstellung von Assistenzlehrkräften ermöglicht wird. Und schließlich brauchen wir umfangreiche Schutzmaßnahmen für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen unter anderem Luftfilteranlagen zur Raumdesinfektion, FFP2-Schutzmasken für alle Lehrkräfte und zum nächstmöglichen Zeitpunkt auch für die Schülerinnen und Schüler, mehr Kapazitäten für Schnelltests bei Risikogruppen und eine beschleunigte Digitalisierung der Schulen, damit digitaler Unterricht und Unterricht in Hybridform jederzeit ohne Einschränkungen möglich ist.
Im Bereich des Sports gilt es aus Sicht der FDP/DVP Fraktion, die Schließung des Freizeit- und Amateursportbetriebs jenseits des Individualsports auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Ziel muss ein differenziertes Konzept sein, das Freizeit- und Amateursport vor allem auch für Kinder und Jugendliche unter klaren Hygienevorgaben weiterhin ermöglicht.
“Wenn man die Strategie so fortführt, wird nach dem Teil-Lockdown der totale Lockdown kommen.”
Dr. Hans-Ulrich Rülke, Fraktionsvorsitzender FDP/DVP-Fraktion
Die Schließungsanordnung für die Gastronomie sowie das Verbot touristischer Reisen stellt im Verhältnis zu den Erkenntnissen über die Orte, an denen sich Menschen mit dem Corona-Virus infizieren, einen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Laut einer Statistik des Sozialministeriums sind diese Betriebe gerade einmal zu vier Prozent an den bekannten Infektionen beteiligt, und wie aus der Presseberichterstattung der vergangenen Monate zu entnehmen war, sind Infektionen häufig bei großen privaten Feiern entstanden.
Die Hotel- und Gastronomiebranche hat seit März große Anstrengungen unternommen, um sich für eine zweite Welle der Corona-Infektionen zu wappnen und die Infektionsrisiken zu minieren – um werden nun damit konfrontiert, dass sie trotzdem durch die Landesregierung in eine vierwöchige Schließzeit geschickt werden.
Die jüngsten Einschränkungen sollen die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung signifikant reduzieren, während die Wirtschaft möglichst von Schließungen freibleibt. Die Einbeziehung der Kultur- und Veranstaltungsbranche in die Schließungsanordnung, die gewissermaßen impliziert, dass dort verzichtbare Kontakte geschaffen werden, verkennt die ökonomische Relevanz der kulturschaffenden Branche, die eben auch wirtschaftlich handelt.
– Unser Entschließungsantrag zur sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 1.11.20 –
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,
Drucksache 16/9200 – Entschließungsantrag der FDP/DVP-Fraktion
Rede von Dr. Hans-Ulrich Rülke im Landtag , 30.10.2020
„Was wir aber vermissen ist eine langfristige Strategie“, so Dr. Hans-Ulrich Rülke kritisch, diese Regierung hätte die Zeit seit dem Frühjahr offenbar nicht genutzt: „Was machen Sie, wenn diese Maßnahmen bis Ende November nicht fruchten? Sie haben dafür keinerlei Plan!“
Unsere Ansprechpartner:
Abgeordnete
Jochen Haußmann
Mitarbeiter
Benjamin Haak
Stephanie Herborn
Marc Juric
Jana Lux
Thilo Weber
Sarah Wehinger
Wir brauchen einen Kraftakt für die digitale Infrastruktur
Der steigende Bandbreitenbedarf muss sich in den Investitionen zur digitalen Infrastruktur bereits heute wiederspiegeln.
Seit Beginn dieser Legislaturperiode wird Innenminister Thomas Strobl nicht müde anzukündigen, er wolle bis zum Jahr 2021 auch den letzten Schwarzwaldhof an das schnelle Internet angeschlossen haben. Zur Mitte der Legislaturperiode hat er dieses Ziel relativieren müssen. Wie wichtig die digitale Infrastruktur für alle Bereiche des Lebens ist, hat spätestens die Zeit der Corona-Pandemie gezeigt. Der Lockdown der hat wie ein Brennglas deutlich die Defizite der digitalen Infrastruktur aufgezeigt. Häufig sind die Anbindungen ans schnelle Internet zu langsam oder zu instabil. Videotelefonie, Home-Office und Home-Schooling waren nur bedingt oder mit Einschränkungen möglich.
Damit diese Defizite schnell bewältigt werden können, bedarf es einem Kraftakt bei der digitalen Infrastruktur. Wie dieser gelingen kann, an welchen Stellschrauben dafür gedreht werden muss, welche Lösungen es geben kann und welche Erfahrungen Sie gemacht haben, darüber haben wir mit Experten in unserem Webtalk diskutiert.
Ihr habt unseren Webtalk verpasst?
Kein Problem! Hier zum Nachschauen.
Daniel Karrais
„Gerade die Corona-Pandemie mit der verbundenen Notwendigkeit, vermehrt im Home-Office zu arbeiten, die Kinder im Home-Schooling zu unterrichten und mit der Familie Video-Telefonie zu betreiben, hat gezeigt, wie wichtig eine gute digitale Infrastruktur ist. Alle Digitalisierungsbestrebungen fußen auf einem schnellen Internet. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob man in einer dichtbesiedelten Stadt oder im Ländlichen Raum lebt. Wir in Baden-Württemberg haben da einen großen Nachholbedarf. Wir dürfen nicht weiter abgehängt werden. Daher lautet mein dringender Appell an die Privatwirtschaft und an die Bundes- und Landesregierung: An der Digitalisierung darf nicht gespart werden.“
Michael Schlichenmaier
In der von Guido Gehrt, Leiter der Bonner Redaktion des Behördenspiegels, moderierten Diskussion betonte Michael Schlichenmaier, stellvertretender Stabsstellenleiter des Landkreistags Baden-Württemberg sowie Mitglied der Clearingstelle Digitale Infrastruktur im Ländlichen Raum, die Bedeutung des schnellen Internets. Daher sei es folgerichtig, dass von staatlicher Seite nur auf glasfaserbasierende Technologien gefördert werden. Als die großen Herausforderungen identifizierte er die finanzielle Ausstattung für Breitbandinfrastruktur, in die mehr investiert werden müsse. Auch werde die Bürokratie für viele Antragssteller als überbordend wahrgenommen, was die Antragsstellung unnötig verkompliziere und verlängere.
Kai Schinkel
Der Unternehmer und Mitglied des DIHK-Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie machte noch einmal deutlich, dass die Politik im Rahmen des geförderten Ausbaus, mit der Privatwirtschaft, also dem eigenwirtschaftlichen Ausbau, in einen engeren und verbesserten Austausch gehen müsse. Doppelstrukturen gelte es zwingend zu vermeiden. Zudem machte er die Bedeutung des Breitbandausbaus auch für die ärztliche Versorgung deutlich, denn Telemedizin werde eine immer größere Bedeutung in der Gesellschaft bekommen. Zudem werde der Breitbandbedarf durch die voranschreitenden Technologien, beispielsweise bei der Videoüberwachung, stetig steigen.
Mehr zu unserer Digitaloffensive nach Corona…
Unsere Ansprechpartner:
– Eine Agenda für den Aufbruch –
Deutschland steckt voller Potenziale. Ob in der Kita, der Schule, im Büro, im Labor oder zuhause: Überall beweisen die Menschen unseres Landes Kreativität, Erfindergeist und Engagement. Eine ausufernde Bürokratie, eine kleinteilige Regelungswut und das krampfhafte Festhalten am Althergebrachten verhindern nur leider allzu oft, dass sich diese Potenziale richtig entfalten können.
In der Corona-Krise sind die vielen kleineren und größeren Hindernisse und Hürden, die jeder aus dem Alltag kennt, noch deutlicher. Nun werden die negativen Folgen der verschlafenen Digitalisierung der Schulen offensichtlich. Unternehmen müssen erkennen, wie wenig Spielraum ihnen etwa das Steuerrecht gerade in Zeiten der Krise lässt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden unter den Folgen einer schwächelnden Wirtschaft. Gleichzeitig entwickelt sich der Mangel an ausreichendem, bezahlbarem Wohnraum zu einem noch größeren Problem für Wohnungssuchende.
Mehr denn je braucht es jetzt Mut zu Reformen und Veränderungen. Gerade jetzt muss sich die Kraft, die in jedem schlummert, bestmöglich entfalten können. Die FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, für 10 zentrale Felder, von der Wirtschaft, über die Bildung und Digitalisierung bis zur Finanzpolitik, ein klares Programm für den Aufbruch zu formulieren. Diese Agenda „Deutschland entfesseln“ macht das Land bereit für den Weg aus der Krise in die Zukunft.
I. Wirtschaft
Die Corona-Pandemie bedeutet einen massiven Einschnitt für die Menschen und für die Wirtschaft in Deutschland. Die politischen Maßnahmen, die zu Beginn der Pandemie beschlossen wurden, waren in vielen Fällen richtig und notwendig. Jetzt, nach monatelanger Erfahrung mit Covid-19, ist es aber an der Zeit, die Weichen für den Aufbruch aus der Krise zu stellen. Neben der Krisenbewältigung wollen wir die in Krisenzeiten stärkere Reformbereitschaft nutzen, um mutige und entschiedene Strukturreformen durchzuführen. Reformen, die unser Land schon länger dringend benötigt.
Für den Aufbruch aus der Krise fordert die FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz:
II. Bildung
Deutschlands Wohlstand ist untrennbar mit Bildung verbunden. Das Bildungsideal der Freien Demokraten geht weit über die bloße Wissensvermittlung hinaus. Wir wollen, dass jeder Schulabgänger in Deutschland in der Lage ist, selbstbestimmt zu handeln und Verantwortung für sein Leben, für das Leben seiner Familie und für die Gesellschaft zu übernehmen. Bildung soll insbesondere junge Menschen darauf vorbereiten, mit erworbenen Fähigkeiten unter Anwendung von erlernten Fähigkeiten auf neue persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen reagieren- und selbstbestimmt Lösungen entwickeln zu können.
Wir müssen feststellen, dass das Schulsystem und die Bildungspolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielfach mangelhaft auf den gesellschaftlichen Wandel reagiert hat. Wir schaffen es nur noch unzureichend, das Bildungspotenzial der Bürgerinnen und Bürger zu heben, wodurch die Innovationskraft, der Fortschritt und der Wohlstand unseres Landes gefährdet sind. Wir wollen die individuellen Potenziale aller jungen Menschen entfalten, fördern und unterstützen. Wir wollen, dass jeder Mensch in unserem Land die Chance auf bestmögliche Bildung erhält.
Hierfür wollen wir Deutschland entfesseln, Bildungshürden abbauen und die Bildungsnation neu aufbauen:
III. Finanzen
Das deutsche Steuerrecht ist viel zu kompliziert – dafür spricht allein die bloße Anzahl an Steuern, die wir haben: 40. Die Senkung von Steuern setzt gleichwohl eine strenge haushalterische Disziplin und das Bedenken sozialer Komponenten voraus.
Die FDP-Fraktionsvorsitzenden-konferenz schlägt folgende Maßnahmen zur Entfesselung des Steuerrechts vor:
IV. Verkehr und Planungsrecht
Eine moderne und gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur ist das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Sie ist Voraussetzung für eine funktionierende Wertschöpfungs- und Logistikkette und ebenso Grundlage zur Erfüllung individueller Mobilitätsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger.
Um den Bedürfnissen der Menschen in der Zukunft gerecht zu werden und die Infrastruktur verkehrsübergreifend gleichermaßen voranzubringen, müssen folgende Maßnahmen zur Verringerung der Bürokratiebelastung ergriffen werden:
V. Digitalisierung
Die Digitalisierung bietet zahllose Chancen für wirtschaftliches Wachstum und zur Beschleunigung und Effizienzsteigerung in der Verwaltung. Deutschland muss diese Chancen nur nutzen und die richtigen Voraussetzungen hierzu schaffen.
Die FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz fordert daher:
VI. Wissenschaft und Forschung
Der Wohlstand Deutschlands als Wissens- und Industriegesellschaft hängt entscheidend davon ab, inwieweit es gelingt, in Wissenschaft und Forschung eine Spitzenstellung einzunehmen. Nur eine freie und eigenverantwortliche Forschung mit ausreichend Luft zum Atmen wird exzellente Forschungsergebnisse liefern und damit der Gesellschaft dienen können. Über die Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen bestimmt die Gesellschaft mit. Bei der vorangehenden Forschung und der Lehre setzt sich die Wissenschaft hingegen ihre Grenzen selbst im gemeinsamen wissenschaftlichen Diskurs und in Eigenverantwortung. Denn nur ohne Denkverbote erreichen wir optimale Rahmenbedingungen, sowohl für Studium und Lehre, als auch für Spitzenforschung.
Für einen Aufbruch in Wissenschaft und Forschung wird jedes Talent gebraucht. Deutschland kann es sich nicht leisten, dass die Bildungschancen von Menschen vom Elternhaus oder der finanziellen Situation abhängen. Vor diesem Hintergrund fordert die FDP-Fraktionsvorsitzenden-konferenz:
VII. Familie und Gleichstellung
Die Menschen aller Geschlechter in Deutschland haben viele Talente und sind voller Tatendrang. Bürokratische Regelungen und ein komplizierter Staat erschweren aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sind eine unnötige Beschränkung bei der Verwirklichung der eigenen Freiheit.
Die FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz fordert daher folgende Maßnahmen um Familien das Leben leichter und jedem ein selbstbestimmtes, freies Leben möglich zu machen:
VIII. Bauen und Wohnen
Die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auf das Bau- und Wohnungswesen. Die gesamte Branche liegt wie unter einem Brennglas der gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen. Daneben kämpft der Bau- und Wohnungssektor weiterhin mit „alten“ Problemen wie dem Wohnraummangel in Ballungszentren. Regulatorische Eingriffe, wie der Mietendeckel und die Mietpreisbremse, bieten keine Lösungen und die erhoffte Bautätigkeit bleibt aufgrund bürokratischer Hürden weiter aus.
Wir wollen diese Blockaden in der Bau- und Wohnungspolitik endlich lösen, mit dem Ziel Deutschland zu entfesseln! Die FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz fordert deshalb:
IX. Landwirtschaft
Die deutsche Landwirtschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen, die durch die Corona-Krise oft verschärft wurden.
Damit die Landwirte in Zukunft konkurrenzfähig bleiben und um einen effektiven Tier- und Umweltschutz zu gewährleisten, fordert die FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz:
X. Kultur
Die Kulturschaffenden in Deutschland beweisen jeden Tag Kreativität und Innovationsstärke. Bürokratische Hemmnisse machen es ihnen aber oft schwer, ihr ganzes Potential voll auszuschöpfen. Die Corona-Krise hat sich schließlich zu einer ernsten Bedrohung für viele entwickelt.
Um eine Umfeld zu schaffen, das der Kreativität freien Raum lässt, stellt die FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz folgende Forderungen:
Beschluss der FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz vom 23. Oktober 2020
Ein bisschen mehr Klischee, Herr Kretschmann!
Strebsam soll er sein, der Schwabe – und sparsam. „Schaffe, schaffe, Häusle baue“, ist der Ausspruch zum weit über die Grenzen unserer Region bekannten Klischee. Über den Wahrheitsgehalt solcher Klischees lässt sich bekanntermaßen streiten, und doch wünscht man sich in diesen Tagen, der in Schwaben geborene und schwäbisch-schwätzende Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grünen) würde ein bisschen mehr wie ein sparsamer Schwabe agieren.
Sage und schreibe knapp 13,5 Milliarden Euro – in Zahlen 13 500 000 000 – nimmt das Land Baden-Württemberg unter der grün-schwarzen Kretschmann-Regierung im Zuge des Nachtragshaushaltes an neuen Schulden auf. Das entspricht einer Neuverschuldung von 30 Prozent des seitherigen Schuldenstands! In einem Jahr! Was wir in diesen Tagen erleben, ist eine Schuldenorgie nie dagewesenen Ausmaßes. Bemerkenswert dabei: Erst im vergangenen Jahr hatten wir als FDP/DVP Fraktion gemeinsam mit CDU, SPD und Grünen eine Schuldenbremse in der Verfassung verankert. Die Art und Weise, wie die Koalition diese nun auslegt, führt diese nun ad absurdum. Zwar kann zum Beispiel in Fällen von Naturkatastrophen von der Schuldenbremse abgewichen werden, allerdings bedient sich die Regierung dieser Ausnahmeregel, um seither nicht finanzierte Wünsche umzusetzen. Die Corona-Krise taugt daher nicht als Rechtfertigung für dieses Ausmaß an Verschuldung: So wurden erst 1,4 Milliarden von 5 Milliarden der Corona-Hilfsgelder abgerufen und weitere Rücklagen aus den Haushalten stehen noch bereit.
Viele Investitionen haben überhaupt keinen Bezug zu Corona: Was zum Beispiel haben Photovoltaik-Förderprogramme mit der Corona-Krise zu tun? Eignen sich Photovoltaikanlagen zu einer pandemiebedingten Folgenbekämpfung? Wohl kaum. Und so zeigt sich das, was auch der Rechnungshof bestätigt hat: Die neuen Schulden sind vielfach schlichtweg nicht mit der Pandemie-Bekämpfung zu begründen.
„Wir sehen uns mit diesen kritischen Feststellungen des Rechnungshofes in unserer Haltung voll bestätigt. Die vorgesehenen Ausgaben sind vielfach nicht mit der Corona-Sondersituation zu begründen, sondern stellen eine Wahlgeschenkfinanzierung unter dem Deckmantel von Corona dar. Dieser Kurs wird uns und die künftigen Generationen auch mit einem viel zu langen Rückzahlungszeitraum teuer zu stehen kommen. Wir werden sehr genau prüfen, ob dieser Staatshaushalt rechtlich Bestand haben wird.“
Dr. Hans-Ulrich Rülke
Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass die Grün-Schwarze Landesregierung ein halbes Jahr vor der Landtagswahl noch ein paar Wahlgeschenke verteilen möchte. Das Perfide daran: Diese Wahlgeschenke werden teuer bezahlt, jedoch nicht von Kretschmann und Co., sondern von den zukünftigen Generationen. Entsprechend großzügig ist der Rückzahlungszeitraum von 25 Jahren angesetzt. Als FDP/DVP lehnen wir diese Schuldenorgie und Umgehung der Schuldenbremse zulasten der nachfolgenden Generationen ab. Sollte die Regierung diesen Weg fortführen, werden wir gerichtliche Schritte prüfen. Wir appellieren daher an die Kretschmann-Regierung, im Sinne der zukünftigen Generationen auf die Wahlkampfgeschenke zu verzichten.
Übrigens soll Ministerpräsident Kretschmann eigentlich durchaus sparsam sein. Er lasse seine Schuhe zum Besohlen noch zum Schuhmacher bringen, sagt man. Aber da geht es ja um sein eigenes Geld…
Unsere Ansprechpartner:
Sechs Themen, die Baden-Württemberg bewegen!
Teil 2: Bildung, Polizei, Pflege
Ob Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung, Bildung, Pflege oder Polizei – Baden-Württemberg steht in vielen Bereichen vor großen Herausforderungen. Wir möchten euch unsere Ideen für das Land kurz und bündig in zwei Teilen vorstellen.
Im zweiten Teil blicken wir heute auf die Themen Bildung, Polizei und Pflege. Bei allen negativen Konsequenzen für unser Bildungswesen hat die Corona-Pandemie auch eines bewirkt: Das allgemeine Bewusstsein für den Wert der Bildung zu schärfen. Das individuelle und das soziale Lernen in Einklang zu bringen, ist nach unserer Überzeugung eine Aufgabe, die einer liberalen Bildungspolitik geradezu auf den Leib geschneidert ist.
Neben der Corona-Krise stellen uns alle aber auch andere aktuelle Entwicklungen vor Herausforderungen. Die Krawallnacht in Stuttgart hat gezeigt, wie fragil die Gesellschaft ist und wie schnell Entwicklungen unkontrolliert eskalieren können. Es ist geboten, nach Gründen zu fragen und diese dann auch anzugehen. Dabei darf es keine Tabus geben. Klare rechtsstaatliche Maßnahmen, beispielsweise zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und des Missbrauchs von Aufenthaltsrechten, müssen in die Tat umgesetzt werden. Es geht jetzt nicht nur darum, hinter der Polizei zu stehen, sondern ihr auch den Rücken zu stärken – mit besserer Ausstattung, Organisation und Personal.
Auch die Pflege steht vor großen Herausforderungen: Die grün-schwarze Koalition hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Pflegekammer mit Pflichtmitgliedschaft und Pflichtbeiträgen einzurichten. Die Pflegekammer hat aber keinerlei Einfluss auf die unmittelbaren Arbeitsbedingungen, wie vor allem das Gehalt. Wir meinen: Verbesserungen für die Pflege: Ja! Neue bürokratische Strukturen mit hohen Kosten: Nein!
Für ein Recht auf beste Bildung
Bei allen negativen Konsequenzen für unser Bildungswesen hat die Corona-Pandemie auch eines bewirkt: Das allgemeine Bewusstsein für den Wert der Bildung zu schärfen. Während zuvor junge Menschen auf Kosten ihrer Schulbildung streikten, gehen mittlerweile Eltern für die Bildungschancen ihrer Kinder auf die Straße. Auch die FDP/DVP Fraktion sieht eine ihrer Kernaufgaben darin, einem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen, das bis vor kurzem nach allgemeinem Verständnis als Selbstverständlichkeit galt: dem Recht auf Bildung. Dabei gilt es nach unserer Auffassung nicht nur dafür zu sorgen, dass der Unterricht auch unter Pandemiebedingungen im vorgesehenen Umfang stattfinden kann, sondern auch, dass er höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Wir haben deshalb ein Positionspapier vorgelegt mit dem Ziel, das Veränderungspotenzial der Krise für eine erstklassige Bildung zu nutzen. Neben fünf Akutforderungen, die unsere Schulen für Krisen wetterfest machen sollen, ziehen wir auch fünf grundlegende Schlussfolgerungen. Einerseits gilt es, insbesondere die Digitalisierung für die bestmögliche Entfaltung jedes einzelnen Schülers zu nutzen. Andererseits wurde durch die Schulschließungen noch einmal deutlich, dass weder die Mitlernenden noch der Lehrer in einem gelingenden Lernprozess ersetzbar sind. Das individuelle und das soziale Lernen in Einklang zu bringen, ist nach unserer Überzeugung eine Aufgabe, die einer liberalen Bildungspolitik geradezu auf den Leib geschneidert ist.
Unsere Ideen zur Bildung, damit wir #wiederspitzewerden
Wirksame Mittel für unsere Polizei statt nur Placebo
Seit rund zwei Jahren forciert Innenminister Strobl weitere Verschärfungen im Polizeigesetz. Der Entwurf liegt seit einigen Monaten vor. Er enthält beispielsweise eine Ausweitung der Nutzung von Bodycams in Wohnungen, das Recht auf eine weitgehend anlasslose Identitätsfeststellung und Durchsuchung bei Großveranstaltungen und eine kaum eingegrenzte verdeckte Kennzeichenerfassung. Organisationen wie der Anwaltsverband äußerten bereits „durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken“ hinsichtlich einzelner Maßnahmen. Zufällig beginnen die Gesetzesberatungen nur wenige Wochen nach der Stuttgarter Krawallnacht und schon fordern CDU-Politiker mit Verweis hierauf die bedingungslose Unterstützung für das Vorhaben ein. „Wir müssen aber genau auseinanderhalten, was echten Mehrwert für die Polizeiarbeit hat und was reines Placebo ist“, warnt unser innenpolitischer Sprecher Prof. Dr. Ulrich Goll.
Dass wir heute weniger Polizei auf der Straße als 2016 haben, weil der Innenminister seine Einstellungsoffensive zu spät begann oder sich zehn Polizisten ein Smartphone teilen müssen, sind die wirklichen Probleme für die Polizei – und nicht unzureichende Gesetze.
„Herr Strobl wollte die Polizeireform zunächst klammheimlich innerhalb von drei Wochen noch vor der Sommerpause durch den Landtag peitschen. Das haben wir verhindert, weil es aus unserer Sicht zwingend einer öffentlichen Expertenanhörung bedarf“
Prof. Dr. Ulrich Goll
Die Expertenanhörung soll voraussichtlich nach der Sommerpause stattfinden. Die FDP/DVP Fraktion wird danach Änderungsanträge einbringen, um sicherzustellen, dass Bürgerrechte nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden.
Pflegekammer
Die grün-schwarze Koalition hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Pflegekammer einzurichten. Hierzu wurde im Jahr 2018 eine Umfrage durchgeführt, die jedoch nur selektiv erfolgte. Dabei waren die Fragen aus unserer Sicht auch so gestellt, dass man fast schon automatisch zu einer positiven Einschätzung über die Wirkung einer Pflegekammer kommen musste. Einen ausdrücklichen Hinweis, dass es um eine Pflichtmitgliedschaft mit Pflichtbeiträgen geht, hat auf dem Fragebogen selbst gefehlt. Auch wurde nicht klar benannt, dass die Pflegekammer selbst eben gerade keine Tarifvertragspartei ist und deshalb auf die unmittelbaren Arbeitsbedingungen, wie vor allem das Gehalt, keinerlei Einfluss hat. Wir als FDP/DVP Landtagsfraktion meinen, dass die Pflege ein sehr wichtiger Bereich ist, der gestärkt werden soll. Hierzu haben wir ein umfassendes Papier anhand von sechs Schwerpunktbereichen erarbeitet, das in unserem Internetauftritt einsehbar ist.
Verbesserungen für die Pflege:
Ja!
Neue bürokratische Strukturen mit hohen Kosten:
Nein!
Alles Weitere zur Pflegekammer finden Sie hier.
Sechs Themen, die Baden-Württemberg bewegen!
Teil 1: Wirtschaft, Finanzen und Digitalisierung
Ob Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung, Bildung, Pflege oder Polizei – Baden-Württemberg steht in vielen Bereichen vor großen Herausforderungen. Wir möchten euch unsere Ideen für das Land kurz und bündig in zwei Teilen vorstellen.
Im ersten Teil blicken wir heute auf die Themen Konjunktur, Digitalisierung und Finanzen. Denn: Alle Zahlen weisen darauf hin, dass wir vor einer handfesten Konjunkturkrise stehen. Die Politik muss angesichts dieser ernsten Situation eine Antwort darauf geben, wie es weitergehen kann. Wir haben ein Papier erstellt, in dem Wege aus der Wirtschaftskrise mit klarem liberalen Kompass dargestellt werden. Nur ein Vielklang aus Entlastungen, Entbürokratisierungen, unternehmerischen Freiräumen, Stärkung der Infrastruktur – vor allem im digitalen Bereich – und einer richtigen Technologiepolitik – etwa der Abkehr von der in vielerlei Hinsicht schädlichen Fokussierung auf batteriegetriebene Mobilität – wird den Aufschwung unterstützen können. Unsere Politik nach liberalem Kompass kann sich auch und gerade in schweren Zeiten treu bleiben. Verantwortung für morgen braucht eine klare Sicht auf die Realitäten und Ideen.
Wege aus der Wirtschaftskrise – ein liberaler Kompass
Umsatzausfälle in Milliardenhöhe und flächendeckende Kurzarbeit sind die Vorboten einer Rezession, bei der es um nicht weniger geht als unseren Wohlstand in Baden-Württemberg. Mit einem Konjunkturpaket im Volumen von rund 130 Milliarden Euro will die Bundesregierung den schwierigen Weg aus der Krise bewältigen. Bundestag und Bundesrat haben am 29. Juni 2020 mit dem Corona-Steuerhilfegesetz die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer, einen Kinderbonus sowie steuerliche Erleichterungen und Überbrückungshilfen gerade für kleine und mittelständische Unternehmen beschlossen. Diese Maßnahmen mögen geeignet sein, um das Konsumklima zu verbessern und die Konjunktur anzukurbeln. Sie sind aber auch verbunden mit Bürokratie und nur auf einige Monate angelegt. Vor allem aber bleiben Bundes- und Landesregierung weit hinter den aus unserer Sicht erforderlichen Maßnahmen zurück, die wir bereits Mitte Mai in einem Positionspapier dargelegt haben.
Für die FDP/DVP Faktion ist klar, dass es nur mit einem klaren liberalen Kompass und einem umfassenden Maßnahmenbündel gelingen kann, die Talsohle der Rezession schnell zu durchschreiten. Daher trägt das Papier unter dem Titel „Liberale Wege aus der Wirtschaftskrise“ zahlreiche Konjunkturimpulse zusammen, mit denen wir in zwei Sonderkonjunkturjahren die hiesige Wirtschaft auf Spur halten und den Wohlstand und die Arbeitsplätze im Land sichern wollen.
Grundlagen der Digitalisierung für den Alltag
Inzwischen ist es in fast jedem gesellschaftlichen Bereich selbstverständlich geworden, seine Geschäfte und Belange online abzuwickeln und erledigen zu können. Wir Freie Demokraten möchten, dass das auch bei Verwaltungsdienstleistungen selbstverständlich ist. Denn damit geht eine erhebliche Zeitersparnis einher, gleichermaßen für Verwaltungspersonal und Bürger. Auch eine Einsparung von unterschiedlichen Ressourcen ist damit möglich. Alles in allem sind E-Government-Dienste ein wichtiger Schritt in Richtung Bürokratieabbau.
Grundlage für jegliche Digitalisierungsbestrebungen ist ein flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes. Denn nur mit schnellem Internet lassen sich neue digitale Anwendungen und Produkte nutzen und weiterentwickeln. Für uns Freie Demokraten bedeutet schnelles Internet 1000 Mbit/s und nicht – wie für die Landesregierung – Bandbreiten von 30 Mbit/s. Wir müssen jetzt zukunftsorientiert handeln um den zunehmenden Bedarf an Bandbreite von Unternehmen, Verwaltungen und Privatpersonen decken zu können.
Um die Mammutaufgabe Digitalisierung stemmen zu können fordern wir Freien Demokraten die Einrichtung eines eigenständigen Digitalisierungsministeriums. Digitalisierung muss auf Landesebene endlich zur Chefsache gemacht werden, halbherzige und schlecht umgesetzte Lösungsansätze wie die Bildungsplattform „ella@BW“ können nicht unser Anspruch sein. Wir brauchen jetzt digitale Lösungen, die das Leben der Menschen einfacher und besser machen. Dabei müssen auch die potentiellen Risiken von Digitalisierung, wie etwa Cyber-Sicherheit und der Schutz kritischer Infrastruktur, ernst genommen werden. Für uns ist wichtig: Alle Menschen müssen von Digitalisierung profitieren und niemand darf sich zurückgelassen fühlen.
So möchten wir aus Baden-Württemberg ein #Smartesländle machen:
Bleibt alles anders
Corona-Krise wendet die Vorzeichen der Finanzpolitik der Landesregierung – scheinbar
Die Finanzpolitik der Landesregierung kam seither so seriös daher: keine neuen Schulden gemacht, sogar 1,25 Milliarden getilgt. Und nun, coronabedingt: 5 Milliarden Euro Schuldenaufnahme für Krisenhilfen, bis zu weiteren 7 Milliarden sind möglich aufgrund der Steuerausfälle in 2020 und 2021. Wahrscheinlich werden diese auch ausgeschöpft. Am Ende könnten 12 Milliarden Euro neue Kredite aufgenommen werden, bei einem Schuldenstand von 45 Milliarden und einem Haushaltsvolumen von ca. 53 Milliarden Euro pro Jahr.
Corona ist ein großer Einschnitt. Was aber wie eine 180 Grad-Wendung aussieht, passt in Wahrheit zum gezeigten Verständnis von Staatsfinanzierung der Grünen und CDU. Man sieht sich nicht in der Verantwortung für die Landesschulden, besonders nicht, wenn man dadurch andere Ausgaben kürzen muss. Daher hat das Land seit 2017 eben nicht, wie eigentlich vorgeschrieben, knapp 7 Milliarden Euro an Schulden getilgt, sondern eben nur 1,25. Der Rest wurde in Sanierungsinvestitionen umgeschichtet. Dass diese nötig sind, bestreitet niemand, aber eine seriöse Haushaltspolitik hätte diese stemmen können und trotzdem Schulden tilgen. Aber eben auf Kosten von Projekten und neuen Stellen!
Sich bei Einweihungen feiern lassen, ist eben attraktiver als Schulden zu tilgen, die draußen niemanden drücken. Und daher ist auch die Neigung der Regierungsfraktionen, bei der möglichen Schuldenaufnahme ans Äußerste des Zulässigen zu gehen, heute schon zu greifen. Das dies auf Kosten zukünftiger Generationen geht, ist bei den sonst so auf Nachhaltigkeit bedachten Parteien keine Überlegung wert.
Pressemitteilungen
Schuldenbremse ist kein Instrument für Schönwetterhaushalte mit sprudelnden Steuereinnahmen, sondern gebotene Haushaltsdisziplin.
Zur Diskussion über die Hürden für Ausnahmen von der Schuldenbremse sagte der Vorsitzende der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke:
„Ich bin erleichtert, dass Manuel Hagel die gebotene Haushaltsdisziplin mitträgt, gegebenenfalls auch gegen den Widerstand des grünen Koalitionspartners. Denn Andreas Stoch liegt falsch. Bei jährlich einer Billion Staatseinnahmen haben wir kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Die Schuldenbremse ist eben kein Instrument für Schönwetterhaushalte mit sprudelnden Steuereinnahmen, sondern gebotene Haushaltsdisziplin, auch wenn dann nicht jeder Wunsch aus den Ministerien oder jedes politische Ziel umgesetzt werden kann. Es ist ein linker Irrweg, immer mehr Geld ausgeben zu wollen, um staatliches Handeln in alle Lebensbereiche vordringen zu lassen. Es wäre höchste Zeit, übertriebene Wohltaten, wie ein überhöhtes Bürgergeld, eine bürokratische Kindergrundsicherung und die Rente mit 63 zurückzuschneiden.“
Rechnungshof-Hinweise zur Kosteneffizienz und Nutzung vorhandener digitaler Tools ernst nehmen.
Zur Debatte zur Denkschrift 2023 des Rechnungshofs erklärt der haushaltspolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Rudi Fischer:
„Alle Jahre wieder mahnt der Rechnungshof mehr Kostenbewusstsein und mehr Leistungsüberprüfung an. Dazu weist er wiederholt darauf hin, dass es digitale Tools in der Landesverwaltung für die Vereinfachung vieler Prozesse bereits gibt, deren man sich nur bedienen muss. Hier brauchen wir mehr Tempo in den internen Prozessen.
Wenn man aber wie das Sozialministerium Fördergelder ohne Antragskriterien und ohne Verwendungs- und Erfolgskontrolle vergibt, weil das Geld halt da sei, hat man alle Regeln für Fördermittel ignoriert. Da hilft dann auch keine Software.
Auf der anderen Seite kommt man auch seinem gesetzlichen Auftrag, regelmäßig die Gebührensätze für Verwaltungsleistungen zu überprüfen und anzupassen, nur unzureichend und uneinheitlich nach. Das sorgt für einen nicht nachvollziehbaren Flickenteppich bei der Gebührenerhebung und führt zu einer Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger.“
Belastungen müssen aber gleichmäßig verteilt werden, Bauern werden zu stark belastet.
Zur heutigen Aktuellen Debatte über die Haushaltsbeschlüsse 2024 der Bundesregierung erklärt der finanzpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag, Stephen Brauer:
„Die Bundesregierung ist handlungsfähig und hat die Lücke, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für den Bundeshaushalt 2024 entstanden ist, gefüllt. Natürlich sind Mehrbelastungen von 17 Milliarden für die Betroffenen hart, allerdings werden durch das Steuerentlastungsgesetz von 2022 für 2024 Steuern in Höhe von 32 Milliarden gesenkt, sodass unter dem Strich eine deutliche Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger im Land stehen wird.
Die Bauern allerdings werden doppelt bestraft, einerseits durch den Wegfall der Agrardieselsubvention, andererseits durch den Wegfall des grünen Kennzeichens, was neben Kosten auch deutlich mehr Bürokratie bedeutet. Wir begrüßen, dass die FDP-Bundestagsfraktion angekündigt hat, das im Parlament möglichst durch andere Vorschläge ersetzen zu wollen.“
Notlage-Schulden ersetzen kein jahrelanges Spar-Versagen.
Zur heutigen Darstellung der Finanzlage des Landes durch den Finanzminister erklären der Fraktionsvorsitzende Dr. Hans-Ulrich Rülke und der finanzpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Stephen Brauer:
Rülke: „Die Schuldenbremse bleibt. Sie zu schleifen ist mit der FDP nicht zu machen!“
Brauer: „Die Debatte der SPD zielt auf eine Aufweichung der Schuldenbremse hin mit dem alten sozialistischen Evergreen, es gäbe gute Schulden. Ehrlicher wäre es, in den Debattentitel „Abschaffung der Schuldenbremse“ zu schreiben. Man müsse heute Geld aufnehmen, damit der Sanierungsstau aufgelöst werden könne. Und das von einer Partei, die im Bund 21 der letzten 25 Jahre regiert hat.
Dabei haben die Mütter und Väter der Schuldenbremse das in einem staatspolitisch hellsichtigen Moment richtig eingeschätzt. Der Staat muss in einer unvorhergesehenen Notlage sein, um plötzlichen Finanzierungsbedarf nicht über Rasenmäher-Einsparungen erbringen zu müssen, sondern den Weg über eine Verschuldung mit harten Rückzahlungsregeln gehen zu können.
Investitionen sind die Grundlage für Wachstum und Wohlstand im Land. Die Finanzierung dieser Investitionen darf aber nicht durch zusätzliche Schulden finanziert werden, sondern muss durch das Setzen der richtigen Prioritäten erfolgen.
Finanzminister Bayaz forderte am Wochenende einen Abbau von sozialen Wohltaten im Bund, diese seien ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn er mit dem Finger nach Berlin zeigt, verfährt er nach dem abgewandelten Sankt-Florian-Prinzip:
Heiliger Sankt Florian, verschon‘ meinen Haushalt, zünd‘ andere an.
Einen Nachtrag verweigert er, da sonst 1,4 Mrd. sofort getilgt werden müssten. Nach Verkündung des BVerfG-Urteils wurden plötzlich 4,3 Mrd. € „gefunden“, die nun zurückgegeben werden. Das sind fast 1/3 der in Corona aufgenommenen Schulden.
Früher hieß es mal, wir wirtschaften gut und investieren heute, damit es unseren Kindern einmal besser geht als uns. Heute erklären sie, wir belasten unsere Kinder heute schon, denn die nutzen das schließlich auch irgendwann mal. Das ist verantwortungslose Politik.“
Mehr Schulden sind doch nur Steuererhöhungen für unsere Kinder.
Zur Debatte um die Veränderung der Schuldenbremse hin zu mehr Öffnungsmöglichkeiten für Investitionen erklärt Stephen Brauer, finanzpolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion:
„Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schießen wieder die Diskussionen ins Kraut, dass man für Investitionen die Schuldenbremse ´verändern´, sprich abschaffen, müsse. Wo soll das Geld denn herkommen, fragt Ministerpräsident Kretschmann scheinheilig. Ganz einfach, es kommt z.B. aus einem massiv angestiegenen Landeshaushalt, der sich in 12 Jahren grüner Führung fast verdoppelt hat. Die Prioritäten wurden eben falsch gesetzt. Jahrelang wurde konsumiert statt investiert.
Wer mehr Schulden für Investitionen fordert, sagt doch in Wahrheit, dass er an anderer Stelle nichts einsparen will. Da soll der Ministerpräsident doch so ehrlich sein und Steuererhöhungen fordern – und das im Höchststeuerland Deutschland.
Über mehr Schulden die Steuererhöhungen für die dann fällige Tilgung auf unsere Kinder zu verschieben ist unehrlich.“
Ständige FDP-Forderung nach Rückgabe der Schuldenrechte muss nun endlich umgesetzt werden.
Zur heutigen Aussage des Finanzministeriums, dass man vermutlich rund 4 Milliarden eingeräumte Schuldenrechte aus der Pandemie nicht benötige und zurückgeben will, erklärt Stephen Brauer, finanzpolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion:
„Nun also doch. Während man uns im Frühjahr auf eine Anfrage noch erklärte, dass ´die Mittel, die über Corona-Notkredite finanziert wurden, vollständig benötigt werden´, wird nun von einem Puffer von mehr als 4 Milliarden gesprochen, den man zurückzahlen wolle. Das fordern wir schon, seit man 2020 deutlich weniger Steuerausfälle hatte, als man sich Kredite dagegen genehmigt hatte.
Und natürlich hat das Land Gelder für die Pandemie-Bekämpfung in allgemeine Programme umgewidmet. Es fehlt doch eindeutig der Zusammenhang zwischen einem Programm zur ´Förderung der Holzbauweise´ und der Corona-Pandemie. Dies wurde aber mit Schulden aus dem Nachtrag im Oktober 2020 finanziert.
Gut, dass das Bundesverfassungsgericht dem ´Hamstern´ von Kreditrechten einen Riegel vorgeschoben hat. Nun bleibt noch die Frage offen, wie das Finanzministerium mit den nicht benötigten 24 Milliarden Kreditrechten umgeht, die man genauso gehamstert hat.“
Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat weitreichende Auswirkungen auf das Land.
Zu den Auswirkungen des heutigen Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf in der Pandemie aufgenommene Schulden erklärt der Vorsitzende der FDP/DVP-Fraktion, Hans Ulrich Rülke:
„Die Bundesverfassungsrichter haben die Regelungen der Schuldenbremse präzisiert, das begrüßen wir ausdrücklich. Insbesondere kritisieren sie das Vorhalten von Schuldenrechten über einen Haushalt hinaus.
Auch die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg hat die in der Pandemie aufgenommene Schulden über mehrere Haushalte eingeplant und ausgegeben. Hier könnte sich eine sofortige Rückzahlungsverpflichtung der restlichen Mittel ergeben.
Es zeigt sich, dass die ständigen Mahnungen der FDP und unsere Klage gegen die letzte Kreditaufnahme im Juli 2021 absolut gerechtfertigt waren. Wir sehen uns nicht nur vom Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg, sondern auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt.“
Land müsste bei Nachtrag mehr Schulden tilgen, das wäre auch leicht möglich.
Zur heutigen Darstellung der Finanzlage des Landes durch den Finanzminister bemerkt Stephen Brauer, finanzpolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion:
„Der Ministerpräsident hat es verklausuliert, aber es wissen alle: die fetten Jahre sind vorbei. Das Land muss viel stärker in die Aufgabenkritik gehen, denn die Risiken und Unwägbarkeiten waren kaum einmal größer als heute. Die Wirtschaftslage kommt mit Verzögerung nun im Landeshaushalt an.
Dass man bei einem Nachtragshaushalt von Beginn ab 1,4 Milliarden mehr Schulden tilgen müsste, spricht grundsätzlich für unser Land. Der Finanzminister wehrt sich ja auch gegen den Begriff Sparhaushalt, man müsse aber Prioritäten setzen. Da das Land aber auf riesigen nicht genutzten Kreditrechten sitzt, wäre eine solche Tilgung formal ein Leichtes. Da sieht man, welche Spielräume die Landesregierung in Wahrheit hat.“
Besonders der Einbruch bei der Grunderwerbsteuer zeigt, dass der Satz endlich gesenkt werden muss.
Zur heute veröffentlichten Herbst-Steuerschätzung für Baden-Württemberg erklärt Rudi Fischer, haushaltspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion:
„Das Land nimmt dieses Jahr etwas mehr ein, muss aber mehr zahlen. So fasst der Finanzminister die Situation zusammen. Die Entwicklung der Steuereinnahmen folgt der der Wirtschaft. Durch die starken Preiserhöhungen der vergangenen Zeit halten sich die Bürgerinnen und Bürger bei nicht notwendigen Ausgaben zurück. Das führt zu weniger Steuereinnahmen. Jetzt Steuererhöhungen zu fordern ist absolut kontraproduktiv. Nur Aufgaben und Ausgaben kürzen führt langfristig zu einer gesunden Finanzlage. Das Land schiebt unglaubliche 10 Milliarden Euro an nicht getätigten Ausgaben vor sich her, weil man vieles angefangen hat, aber kaum was zu Ende bringt. Dazu haben oftmals die Kommunen die Ko-Finanzierungsmittel nicht mehr, weil sie mit aktuellen Aufgaben wie der Flüchtlingsunterbringung finanziell überfordert sind.
Die Bundessteuern verzeichnen Zuwächse, dagegen zeigt sich in Baden-Württemberg ein eklatanter Einbruch bei den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Die Landesregierung muss endlich den Steuersatz wieder von 5 auf 3,5 % absenken. Das würde zumindest etwas Entspannung bringen und die Bautätigkeit ankurbeln.“
FDP/DVP-Fraktion erstreitet mehr Kontrollmöglichkeiten und schreibt ein Stück Rechtsgeschichte.
Zur heutigen Verkündung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur Klage der FDP/DVP-Fraktion gegen den Dritten Nachtrag zum Haushalt 2021 äußert sich Dr. Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion, wie folgt:
„Das ist ein guter Tag für den Parlamentarismus, wir haben ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben. Dass der Verfassungsgerichtshof der grün-schwarzen Koalition ins Stammbuch schreibt, bei der Nutzung der Schuldenbremse sorgsamer vorzugehen und sich nicht einfach auf ihre Parlamentsmehrheit zu verlassen, ist ein notwendiges Stoppschild für grüne und schwarze Schuldenmacher.
Die FDP/DVP-Fraktion hat für den Landtag mehr Kontrollmöglichkeiten erstritten. Der Verfassungsgerichtshof hat die Wächterrolle der Oppositionsfraktionen deutlich gestärkt, in dem er dem Weg für eine Klage unterhalb der 25%-Grenze aller Abgeordneten frei macht. Wir sind bereit, diese zusätzlichen Möglichkeiten auch zu nutzen.
Auch wenn wir keine Verurteilung der Regierungskoalition erreicht haben, hätte es die Schuldentilgung im Haushaltsjahr 2022 ohne unsere Klage nie gegeben. Dort hat grün-schwarz seinen Fehler eingestanden und die Schuldenrechte aus dem Dritten Nachtrag 2021 zurückgegeben.
Nun werden wir weiter darauf achten, dass die Regierung mit den in der Pandemie aufgenommen Schulden sorgsam umgeht und die nicht benötigten Mittel zurückführt.“
FDP/DVP-Fraktion erstreitet mehr Kontrollmöglichkeiten und schreibt ein Stück Rechtsgeschichte.
Zur heutigen Verkündung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur Klage der FDP/DVP-Fraktion gegen den Dritten Nachtrag zum Haushalt 2021 äußert sich Dr. Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion, wie folgt:
„Das ist ein guter Tag für den Parlamentarismus, wir haben ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben. Dass der Verfassungsgerichtshof der grün-schwarzen Koalition ins Stammbuch schreibt, bei der Nutzung der Schuldenbremse sorgsamer vorzugehen und sich nicht einfach auf ihre Parlamentsmehrheit zu verlassen, ist ein notwendiges Stoppschild für grüne und schwarze Schuldenmacher.
Die FDP/DVP-Fraktion hat für den Landtag mehr Kontrollmöglichkeiten erstritten. Der Verfassungsgerichtshof hat die Wächterrolle der Oppositionsfraktionen deutlich gestärkt, in dem er dem Weg für eine Klage unterhalb der 25%-Grenze aller Abgeordneten frei macht. Wir sind bereit, diese zusätzlichen Möglichkeiten auch zu nutzen.
Auch wenn wir keine Verurteilung der Regierungskoalition erreicht haben, hätte es die Schuldentilgung im Haushaltsjahr 2022 ohne unsere Klage nie gegeben. Dort hat grün-schwarz seinen Fehler eingestanden und die Schuldenrechte aus dem Dritten Nachtrag 2021 zurückgegeben.
Nun werden wir weiter darauf achten, dass die Regierung mit den in der Pandemie aufgenommen Schulden sorgsam umgeht und die nicht benötigten Mittel zurückführt.“
FDP/DVP-Fraktion fordert dies seit langem.
Zu den Plänen für eine Länderöffnungsklausel bei der Grunderwerbsteuer und den unterschiedlichen Stimmen aus der Landesregierung sagt Stephen Brauer, finanzpolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion:
„Die Pläne von Bundesfinanzminister Lindner gehen in die richtige Richtung. Sie geben den Ländern die Möglichkeit, flexibler auf die Situation in ihrem Bundesland reagieren zu können.
Bauen ist in Baden-Württemberg besonders teuer und die Grunderwerbsteuer muss aus dem Eigenkapital gezahlt werden. Deswegen fordert die FDP/DVP-Fraktion seit langem, den Grunderwerbsteuersatz wieder auf 3,5% abzusenken, und hat dies auch immer mit Gegenfinanzierungsvorschlägen verbunden.
Wenn nun flexiblere Möglichkeiten wie z.B. Freibeträge möglich sind, darf die Landesregierung dies nicht ungenutzt lassen. Der Verweis auf geringere Einnahmen ist hier Augenwischerei, brechen die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer aufgrund der massiv zurückgefahrenen Investitionen im Moment auf ca. ein Drittel des eingeplanten Wertes ein. Nur mit einer Senkung der Kosten kann die Bautätigkeit wieder angekurbelt werden, das Land kann dies bei der Steuer tun.“
Hinweis für die Koalition: Sparen heißt weniger Geld ausgeben als geplant.
Der finanzpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Stephen Brauer, erkundigte sich bei der Landesregierung in einem Antrag nach den Planungen zu einem anstehenden Nachtragshaushalt. Die Landesregierung antwortete darauf, momentan gäbe es dazu keine konkreten Planungen. Der Abgeordnete sagt dazu:
„Alle in der Koalition rechnen mit einem Nachtrag, nur das Finanzministerium nicht. Dort verweist man auf die Herbst-Steuerschätzung, die aber für ein ordentliches Nachtragsverfahren noch vor dem Jahreswechsel viel zu spät kommt. Nach der Sommerpause werden wir wieder Haushaltsrunden erleben, mitsamt den vielen Anmeldungen aus den Ressorts. Dabei sollte klar sein, dass wir über einen Spar-Nachtrag reden, und nicht, um mehr Geld zu verteilen.
Während man in den letzten Jahren vor 2020 immer mehr Geld verteilt hat und in der Pandemie Einnahmeausfälle über weitere Schulden ausgeglichen wurden, sieht sich Grün-Schwarz nun notwendigen Sparbemühungen gegenüber. Nachdem sie das offenbar nicht mehr kennen, hier ein Hinweis: Das heißt, weniger Geld ausgeben als eingeplant.“
Es braucht aus Sicht der Freien Demokraten endlich eine angemessene Beteiligung des Landes, was die Finanzierung von Laptops und anderer digitaler Endgeräte an den Schulen anbelangt.
Zur Meldung, dass Kommunen deutlich mehr Geld für Schulmodernisierung fordern, sagt der Fraktionsvorsitzende der FDP/DVP-Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke:
„Wir Freie Demokraten hatten schon in den letzten Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 dringend darauf hingewiesen, dass die Finanzierung der Laptopausstattung für Lehrkräfte auf der Kippe steht. Das wurde – wie inzwischen üblich – von Grün-Schwarz gekonnt ignoriert. Dass wir die Digitalisierung an den Schulen entschieden voranbringen müssen, dürfte wohl jedem klar sein. Es reicht aber nicht, den schwarzen Peter an die Träger vor Ort abzuschieben. Das ist – angesichts der Dringlichkeit und Relevanz der Thematik – weder angemessen noch hilfreich.
Es kann beim besten Willen nicht sein, dass öffentliche oder freie Schulträger sowie der Bund bei der digitalen Ausstattung der Schulen ihr Bestmöglichstes geben, Grün-Schwarz auf Landesebene aber weiter selbstzufrieden den digitalen Schlaf der Gerechten schläft. Es braucht aus Sicht der Freien Demokraten endlich eine angemessene Beteiligung des Landes, was die langfristige Finanzierung der Laptops und anderer digitaler Endgeräte an den Schulen anbelangt.“
Mündliche Verhandlung zeigt unsere berechtigten Bedenken, anders als bei der AfD-Klage.
Zur Ansetzung einer mündlichen Verhandlung in der Klage der FDP/DVP-Fraktion gegen die Schuldenaufnahme aus dem Dritten Nachtragshaushalt 2021 erklärt der Fraktionsvorsitzende, Dr. Hans-Ulrich Rülke:
„Wir begrüßen die Möglichkeit, unsere Argumente nochmals vortragen zu können, und nicht wie bei der Klage der AfD zum gleichen Nachtragshaushalt sofort abgeschmettert zu werden.
Wie berechtigt wir mit unserer Klage liegen, zeigte schon die Haushaltsaufstellung 2022, bei der die Landesregierung und die Koalitionsparteien von einer angestrebten ´materiellen Heilung´ sprachen, weil sie Schuldenrechte zurückführten. Was geheilt werden muss, muss vorher rechtswidrig gewesen sein, ein Schuldeingeständnis erster Klasse.
Damals ging es um nicht mal eine Milliarde Mehrschulden, die sehenden Auges beantragt und genehmigt wurden. Heute sehen wir, dass die Regierung sogar 5,3 Milliarden aus den Corona-Bekämpfungsschulden nicht gebraucht hat. Das hätte sie damals wissen können, ja wissen müssen. Genug Hinweise, auch durch den Rechnungshof, hatte sie ja bekommen.“
Und die Landesregierung muss endlich mit weniger Geld auskommen.
In der abschließenden Debatte über den Haushalt 2023/2024 führt der finanzpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Stephen Brauer, wie folgt aus:
„Die Marathonsitzungen über die Einzelpläne in der vergangenen Woche haben gezeigt, wo die Schwierigkeiten dieser Regierung liegen. Man hat von der Komplementärkoalition, wo beide Partner Mittel für ihr jeweiliges Klientel bekommen, nicht auf den Krisenmodus umgeschaltet. Wenn Mehreinnahmen existieren, wie beispielsweise durch das höhere Umsatzsteueraufkommen infolge der Inflation, werden diese umgehend ausgegeben. Das Geld zerrinnt Grün/ Schwarz zwischen den Fingern. Gesprächskreise, Koordinierungsstellen, Leuchtturmprojekte – man kommt einfach nicht in die Umsetzung. So auch beim Klimaschutz, weil man sich selbst so gefesselt hat, dass man für kraftvolle Signale schlicht kein Geld freimachen kann. Und das obwohl zusätzlich 1,2 Mrd. Euro Schulden aufgenommen wurden. Der Schuldenstand des Landes steigt dadurch auf einen Höchststand von 61 Mrd. Euro.
Finanzminister Bayaz sprach von einem fokussierten Haushalt. Vom Fokus ist nichts mehr übrig, stattdessen könnte man von einer getrübten Linse sprechen, die den Blick auf das Wesentliche verschleiert. Man kann ja schon froh darüber sein, dass der Bund das Land zu Mitfinanzierungen gezwungen hat, wie beispielsweise bei der Abschaffung der kalten Progression. Ansonsten hätte man das Geld weiter für Klientelpolitik im Land verschwendet.“
Konsistente IT-Strategie ist nirgends erkennbar
In der Beratung des Haushalts erklärt der haushaltspolitische Sprecher, Rudi Fischer:
„Die Landesregierung erklärt im Haushalt, dass man nun erkannt habe, dass Digitalisierung eine Daueraufgabe sei. Na herzlichen Glückwunsch, endlich, will man da sagen. Digitalisierung ist halt mehr als Breitband verbuddeln. Die BIT BW wurde damals gegründet, um die Mühen der Ebene der Digitalisierung anzugehen: Standardarbeitsplatz, Standardoberflächen wo sinnvoll. Aber hat man sie dafür ordentlich ausgestattet? Nein, sogar versprochene Stellenumsetzungen aus den Ressorts hat man nicht vorgenommen. Das Innenministerium sagt dazu, dass sei aus ihrer Sicht nicht mehr erreichbar. Wie soll da was vorwärts gehen, angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels im IT-Bereich?
Dazu fehlt eine konsistente Strategie, wie der Rechnungshof ebenfalls jüngst bemerkte. Allerdings mangelt es nicht an Gesprächskreisen, Papiere, Abstimmungen. Nur bei der Umsetzung haperts wieder einmal. Von der Idee, dass man mit der Digitalisierung der Verwaltung irgendwann mal Personal einsparen kann, sind wir Lichtjahre entfernt. Dabei sieht doch jeder, dass wir unsere Flut an Vorschriften schon an vielen Stellen gar nicht mehr umgesetzt bekommen.“
Und CDU macht jeden einzigen Euro Schulden mit, die rechtlich möglich sind
In der Debatte der Haushaltspolitiker führt der finanzpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Stephen Brauer, wie folgt aus:
„„Der Landesregierung fällt die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen in den Schoß. Durch die bevorstehende Rezession kann man 1,2 Milliarden Schulden machen, statt 421 Mio zu tilgen. Grün-Schwarz greift sofort zu, denn Schuldenmachen ist ja auch viel einfacher als zu Sparen. Same procedure as every year! Und Cem Özdemir, den Bayaz selbst für die Kretschmann-Nachfolge ins Spiel gebracht hat, trägt man noch schnell eine höhere Grundschuld ein.
Die begrüßenswerten Entlastungspakete des Bundes wie die Energiekostenzuschüsse oder die Inflationsbekämpfung bei der kalten Progression finanziert die grün-schwarze Landesregierung nur zähneknirschend mit.
Wir erkennen an, dass zur Sicherheit hohe Rücklagen für schwere Zeiten gebildet werden, allerdings ist dies angesichts der aktuellen Entwicklungen in dieser Höhe unnötig. Allein im aktuellen Jahr stehen Mehreinnahmen in Höhe von 1,8 Milliarden zur Verfügung.
Im Land wird derzeit jeder Schuldeneuro ausgenutzt, den die Schuldenbremse zulässt und die CDU ist immer mit dabei. Die Christdemokraten haben den Pfad einer soliden Haushaltspolitik völlig verlassen. “
Wissenschaft, Forschung und Kunst brauchen solides Fundament.
Zur heutigen Abstimmung des Doppelhaushalts für das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sagten der Vorsitzende des Arbeitskreises Wissenschaft, Forschung und Kunst und forschungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Dennis Birnstock:
„Im Einzelplan für Wissenschaft, Forschung und Kunst bildet sich nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft ab. Hier sind Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Engagement gefragt. Wir wollen den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg zum Leuchten bringen – aber nicht mit einer Flut von schiefen Leuchttürmen mit fragwürdigem Fundament, wie es die Regierungsfraktionen planen. Grün-Schwarz schmiedet beim Leuchtturm Innovationscampus Region Rhein-Neckar bereits die Wetterfahne, im Fundament fehlt aber noch immer die notwendige politische Entscheidung zugunsten der Fusion der Unikliniken Heidelberg und Mannheim – obwohl heute sogar die Beschäftigten der Uniklinik Mannheim vor dem Finanzministerium demonstriert haben. Andererseits reißt die Landesregierung bestehende Leuchttürme einfach ab, wie etwa die Landesagentur Leichtbau BW.
Beim lang ersehnten Promotionsrecht für die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften weigert sich die Landesregierung anzuerkennen, dass man diese bereits seit langen Jahren von der FDP-Fraktion eingeforderte Maßnahme notwendigerweise mit Deputatsermäßigungen und einem strukturbildenden Mittelbauprogramm flankieren sollte.
Indes ächzen die Hochschulen unter den gestiegenen Energiekosten und erst gestern funkte die Uni Tübingen SOS. Die Landesregierung aber lehnt unseren Vorschlag für einen Fonds für krisenresiliente Hochschulen ab und setzt auf utopische Energie-Einsparvorgaben von 20 % und eine Haushaltsrücklage, bei der die Wissenschaftsministerin selbst einräumen muss, dass diese nicht alle Preissteigerung wird abfedern können.
Die Landesregierung muss endlich erkennen, dass Wissenschaft und Forschung die Basis unseres wirtschaftlichen Erfolgs und unseres Wohlstands in Baden-Württemberg sind. Sie brauchen das gebührende Fundament und keine Leuchttürme auf Treibsand!“
In der Kulturrunde ergänzte der kulturpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Stephen Brauer:
„Unter Grün-Schwarz wird Kulturpolitik zur Politik der kreativen Mittelumschichtung. Um die Popakademie in Mannheim zu unterstützen streicht die Landesregierung kurzerhand den Innovationsfonds Kunst um eine Million Euro zusammen. Dem Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart nimmt man 800 000 Euro, mit denen nun der Umzug des Landesmuseums Württemberg gestemmt werden soll. Das ist doch Politik nach dem Motto `linke Tasche-rechte Tasche´, nur handelt es sich leider um eine andere Hose. Wenn man diese unaufrichtige Haushaltspraxis weiterdenkt, dann muss man mit Sorge auf die anstehende Sanierung der Staatsoper in Stuttgart blicken – denn wo nimmt die Landesregierung dann wohl die notwendigen Mittel her? Eine Milliarde Euro an Kosten wurde taxiert und die CDU bekommt bereits kalte Füße. Sparen sollte man jedenfalls nicht bei der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, wo schon seit vielen Jahren eigentlich eine 2:1-Förderung zwischen Bund und Land vereinbart ist. Die Landesregierung aber lehnt unseren Haushaltsantrag ab und weigert sich damit, diese Verpflichtung zu erfüllen.“
Statt sich nur nette Sprüche und wertschätzende Worthülsen ins Schaufenster zu hängen, wäre ein wertschätzender Umgang mit dem Sport und mit dem Ehrenamt seitens Grün-Schwarz angebracht.
Zur Haushaltsdebatte bzgl. des Sportteils im Kultushaushalt im Landtag von Baden-Württemberg, sagt der sportpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Dennis Birnstock:
„Zunächst möchte ich allen ehrenamtlich Tätigen in Baden-Württemberg, von denen ein großer Teil im Sport aktiv ist, meinen Dank aussprechen. Denn mit 3,9 Millionen Mitgliedschaften ist der Landessportverband die größte Personenvereinigung in Baden-Württemberg. Der organisierte Sport wäre aus unserem Ländle nicht wegzudenken. Wir müssen deshalb unseren Ehrenamtlichen auch die nötige Wertschätzung entgegenbringen. Eine Möglichkeit der Wertschätzung wäre die rasche Einführung einer Ehrenamtskarte. Doch Grün-Schwarz scheint hier wenig ambitioniert zu sein. Mehr als ein paar Modellregionen, in denen eine Ehrenamtskarte erprobt werden soll, war bisher seitens Grün-Schwarz nicht drin. Für uns Freie Demokraten ist klar: Die Ehrenamtskarte muss schnell und unbürokratisch her und darf nicht an bestehenden Strukturen, wie Übungsleiterlizenzen oder Jugendleiter-Cards, vorbeigehen. Und generell braucht es eine Erleichterung bürokratischer Hürden – insbesondere im Zusammenhang für den nahenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Dabei wird gerade der Sport als verlässliche Struktur von der Stadt bis ins Dorf eine wichtige Rolle spielen.
Weiterhin müssen in Zeiten steigender Energie- und Baupreise die Vereine – insbesondere im Sportbereich – gestärkt werden. Hierbei muss das Augenmerk vor allem auf den Schwimmbädern liegen, denn das ohnehin schon seit Jahren stattfindende Bädersterben wird sonst in die zweite Runde gehen. Nachdem viele Kinder schon während der Corona-Pandemie keinen adäquaten Schwimmunterricht erhalten haben, ist es umso wichtiger, den Unterricht jetzt sicherzustellen. Schwimmen lernt man eben nicht bei minus fünf Grad in der Donau, sondern in Lehrschwimmbecken mit einer entsprechenden Wassertemperatur. Deshalb hat die Fraktion der Freien Demokraten einen Änderungsantrag zum Kultushaushalt zur Sanierung von Lehrschwimmbecken eingebracht. Denn wenn ein Bad erst einmal geschlossen ist, macht es so schnell nicht wieder auf. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit wären energetische Sanierungen bei den oftmals jahrzehntealten Schwimmbädern längst überfällig.
Wir Freie Demokraten sehen es nicht nur kritisch, dass im Sportbereich nicht mehr Haushaltsmittel vorgesehen werden. Besonders dreist ist es, dass Grün-Schwarz eine Stelle im Regierungspräsidium Karlsruhe zur verstärkten Prüfung der verwendeten Mittel der Vereinssportstättenbauförderung schaffen möchte und sich hierbei aus den Mitteln, die anderweitig im Sportbereich verortet sind, bedient. Fairplay sieht definitiv anders aus! Statt sich also immer nur nette Sprüche und wertschätzende Worthülsen ins Schaufenster zu hängen, wäre ein wertschätzender Umgang mit dem Sport und mit dem Ehrenamt angebracht.“
Wir können es uns nicht länger leisten, dass unsere Unternehmen weltweit in der Champions League spielen, unser Land bei Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität aber schwer abstiegsgefährdet ist.
Zur Haushaltsdebatte bzgl. des Kultushaushalts im Landtag von Baden-Württemberg, sagt der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Dr. Timm Kern:
„‚Unser Ziel ist Bildungsgerechtigkeit‘ – so lauten die ersten Worte in den politischen Zielen der Landesregierung zum Kultushaushalt. Weiterhin steht im Koalitionsvertrag von Grün-Schwarz: ‚Wir werden in der kommenden Legislatur den Fokus auf den Ausbau der Qualität setzen‘. Schaut man sich allerdings Bildungsrankings an, stellen sich diese Worte als hohle Werbeslogans heraus. Das Dynamikranking des INSM-Bildungsmonitors 2022 sieht Baden-Württembergs Schulentwicklung der letzten zehn Jahre im Gesamtranking auf Platz 14. Dabei belegt unser Land bei Bildungsarmut und Schulqualität jeweils Platz 15 und bei Internationalisierung Platz 16 – den letzten Platz aller Bundesländer! Laut Vera 8 erfüllen fast ein Drittel der Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards für den mittleren Bildungsabschluss in Mathematik und rund ein Fünftel in Rechtschreibung nicht. Gerade an den Gemeinschaftsschulen schnitten hierbei die Schülerinnen und Schüler schlechter ab als vergleichbare Schülerinnen und Schüler an Haupt-, Werkreal- und Realschulen. Das ist die traurige Realität der Kretschmann’schen Bildungspolitik der letzten elf Jahre.
Man kann zwei Fakten festhalten: Erstens ist Bildungsgerechtigkeit bei Grün-Schwarz nichts Anderes als ein hohler Werbeslogan. Zweitens geht es mit der Bildungsqualität im Land in galoppierender Geschwindigkeit bergab. Doch wie reagiert Grün-Schwarz auf die alarmierenden Zahlen? Der Ministerpräsident kommt nach seinem Kabinettsabend, der sich mit den bereits offenkundigen Problemen befasste, zu dem Ergebnis, dass es in der Bildungspolitik zukünftig mehr Evidenzbasierung brauche. Damit gibt der Ministerpräsident zu, dass man sich bei den bildungspolitischen Entscheidungen und Vorhaben der letzten 11 Jahre offensichtlich nicht um die konkreten Wirkungen und Folgen gekümmert habe. Das ist eine Bankrotterklärung seiner bisherigen bildungspolitischen Verantwortung durch den Ministerpräsidenten höchst selbst!
Nicht nur wegen der Schulpflicht ist das Land jungen Menschen gegenüber verpflichtet, möglichst optimale Bildungsvoraussetzungen zur Verfügung zu stellen. Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität sind hierfür die entscheidenden Werte. Wir können es uns nicht länger leisten, dass unsere Unternehmen weltweit in der Champions League spielen, unser Land bei Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität aber schwer abstiegsgefährdet ist. Wir Freie Demokraten jedenfalls werden uns unermüdlich dafür einsetzen, dass sowohl Bildungsgerechtigkeit als auch Bildungsqualität nicht nur leere Worthülsen und schicke Überschriften bleiben, sondern mit Leben gefüllt und Realität an den Schulen im Land werden.“
Einzelplan der Kretschmann-Koalition mittelmäßig bis mangelhaft.
Im Rahmen der heutigen Haushaltsdebatte zum Etat des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, sagte der energie- und umweltpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Frank Bonath:
„Ein von Krieg und Krise gezeichnetes Jahr neigt sich seinem Ende zu. Viele Menschen blicken mit Sorge auf die Zukunft. Viele Unternehmen fürchten um ihre Existenz. Noch nie stand das Land energiepolitisch vor derart großen Herausforderungen. Noch nie waren Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimafreundlichkeit unserer Energieversorgung derart schwer in Einklang zu bringen. Noch nie fiel ein Einzelplan derart mittelmäßig aus.
Mit dem Ausbau der Windenergie will Grün-Schwarz durch die Krise kommen. Im windschwächsten aller Bundesländer ist die Windkraft vielerorts nicht wettbewerbsfähig. Ihre Auslastung ist dürftig, ihr Energiegewinn ist gering. Während der ihr Anteil an der winterlichen Stromerzeugung erst vergangene Woche bei kaum einem Prozent lag, sollen Energiespar-Apps die Verantwortung für die eklatanten Fehlentscheidungen in der grün-schwarzen Energiepolitik auf die Bürger abwälzen.
Statt die knappen Haushaltsmittel für die immer gleichen Prestigeprojekte zu verheizen, hätte Grün-Schwarz mit dem vorliegenden Einzelplan ein starkes Zeichen für eine krisensichere und technologieoffene Transformation in Baden-Württemberg setzen können. Unsere Anträge zum Aus- und Umbau unserer Versorgungsinfrastruktur, zur Verbesserung der Netze und zum Förderung regionaler Speicherlösungen wurden aber allesamt abgelehnt. Damit bleibt der Einzelplan mittelmäßig bis mangelhaft. Nicht Mittelvergabe nach Mittelmaß, sondern zukunftsfähige Investitionen in die Transformation unseres nach wie vor auf Kohle, Öl und Gas beruhenden Wirtschaftssystems sollten das Gebot der Stunde sein.“
Die Landesregierung blendet die Herausforderungen durch die aktuellen Krisen einfach aus.
Anlässlich der Beratungen über den Etat des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz nimmt der Sprecher für Agrarpolitik und Verbraucherschutz der FDP/DVP-Fraktion, Georg Heitlinger Stellung:
„Der Landwirtschaftsetat der Landesregierung wird der herausragenden Bedeutung der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft sowie des Verbraucherschutzes in keiner Weise gerecht. Er ist ein Beleg dafür, dass Grün-Schwarz völlig ausblendet, dass wir uns aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels und der Ukraine-Krise in einer Zeit befinden, in der Ernährungssicherheit und der Erhalt unserer landwirtschaftlichen Familienbetriebe, unserer wertvollen Ackerböden und Landschaften mehr denn je im Mittelpunkt stehen müssen.
Nicht nur angesichts der angespannten Situation der Welternährung brauchen wir ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Bio und konventionell. Unzählige Studien belegen, dass der Ökolandbau weniger ertragreich ist und fehlende Erträge woanders auf der Welt erzeugt werden müssen. Das macht Bio-Lebensmittel auch nicht per se nachhaltiger. Noch dazu erlebt der Bio-Markt aufgrund der Inflation den schlimmsten Einbruch seit 35 Jahren. Selbst jetzt vor Weihnachten bleiben viele Bio-Produzenten auf Ihren Erzeugnissen sitzen, da die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zunimmt. Die enorm gestiegenen Kosten für Energie, Verpackungen, Transport und Miete treiben die Preise für Lebensmittel in die Höhe. Verbraucher fangen an zu sparen. Anstatt diese Realitäten anzuerkennen, steckt die Landesregierung aber über 25 Millionen Euro in den Aktionsplan Bio, in Bio-Musterregionen und in eine Ernährungsstrategie, mit der die Menschen im Land mit Bio-Lebensmitteln zwangsbeglückt werden sollen. Maßnahmen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien so voranzubringen, dass er nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht, fehlen völlig. Genauso mau sieht es, wenn es um den Verbraucherschutz oder die Veterinärverwaltung geht. Nicht eine Stelle mehr ist für die Chemischen Veterinär- und Untersuchungsämter vorgesehen. Sie leiden seit Jahren unter dem massiven Personalmangel und der gleichzeitig immer größer werdenden Aufgabenflut. Auch die für die Veterinärverwaltung vorgesehenen Stellen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Stattdessen soll die Ausbildung zum Schäfer mit Zuschüssen attraktiver gemacht werden. Zuschüsse helfen aber nicht, sondern ein modernes Wolfsmanagement.
Wir haben Lösungsvorschläge vorgelegt, wie wir beim Wolf einen modernen Artenschutz erreichen und die Weidetierhaltung erhalten können. Wir haben Lösungen für mehr Ernährungssicherheit oder eine zukunftssichere Forstwirtschaft aufgezeigt. Mit der Ablehnung unserer Forderungen hat Grün-Schwarz die Chance vertan, für eine zukunftssichere, ökonomische und ökologische Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie einen starken Verbraucherschutz zu sorgen.“
Erhalt und Sicherung von Infrastruktur deutlich stärken.
Im Zusammenhang mit der Beratung des Haushalts des Verkehrsministeriums im Landtag von Baden-Württemberg sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Dr. Christian Jung:
„Der Haushaltsentwurf des Verkehrs-Ressorts hat eine deutliche Schlagseite. Es wird viel zu wenig in den Erhalt der Infrastruktur und die Sicherheit investiert. Seit sechs Jahren verharren die Mittel für den Erhalt der Landesstraßen und damit vor allem auch der Brücken auf annähernd gleichem Niveau. Dieses ist viel zu niedrig. Stand heute sind 350 Bundes- und 312 Landesstraßenbrücken durch einen Neubau zu ersetzen oder müssen instandgesetzt oder ertüchtigt werden. Somit ist für etwa jede zehnte Brücke eine Erhaltungsmaßnahme einzuleiten. Minister Hermann nimmt Schlaglöcher, Brückensperrungen und bröckelnde Stützbauwerke in Kauf. Auf der anderen Seite explodieren die Mittel für grüne Prestigethemen wie zum Beispiel der Bau von Radschnellwegen. Diese steigen um sage und schreibe 20 Mio. Euro. Im Doppelhaushalt sollen insgesamt 57,4 Mio. Euro für den Neubau von Radschnellwegen und damit Flächenversiegelungen ausgegeben werden. Die Mittel explodieren förmlich um 64 Prozent! Wir haben klar aufgezeigt, wie 100 Millionen Euro mehr für den Erhalt investiert werden können. Das dient der Sicherheit von Brücken, Straßen und Stützbauwerken.
Neben diesem konstruktiven Beitrag zum Erhalt von Landesvermögen bieten wir mit unserem Entschließungsantrag zu synthetischen Kraftstoffen der grün geführten Landesregierung die Möglichkeit, den schönen Reden endlich Taten folgen zu lassen. Steigen Sie mit einer Abnahmegarantie in die Zukunft ein. Mit diesem Instrument werden private Investitionen entfesselt und der Markthochlauf gelingt.
Keine Schlagseite, aber dafür sehr im Zwielicht erscheint die Förderpraxis und damit die Compliance im grünen Verkehrsministerium. Das sage nicht nur ich, sondern auch der Landesrechnungshof und der Bund der Steuerzahler. Sozusagen auf Zuruf und mit eigenen Gutachten wird im Bereich der Elektromobilität ohne Maß und Ziel gefördert. Sei es, dass der fast schon bedeutungslos kleine Fahrschulverband eines grünen Herrn Z. vor Jahren auf eigene Initiative eine üppige Förderung für E-Autos erhielt. Nachgelegt wurde jüngst mit einer erneuten üppigen Förderung von über einer halben Million Euro für Schulungsunterlagen, von denen Fachleute sagen, dass sie niemand braucht. „Fahrschule der Zukunft“ heißt das Konstrukt. Dabei kommt ein weiterer grüner Parteifreund zum Zug, der im Vorstand der vpa Verkehrsfachschule ist. Mit Gutachten im eigenen Auftrag hat es auch die Verkehrswacht geschafft, 400.000 Euro Landesgelder für das Projekt eAuto-ausprobieren zu erhalten. Von diesem Projekt hört man aber, dass in erster Linie mit den Autos privat gefahren und die Interessenten für Probefahrten regelmäßig in die Röhre schauen.
Als krönenden Abschluss des Compliance-Themas erwähne ich die Tätigkeit eines mehr oder weniger prominenten Grünen mit Namen A., der sich im Zusammenhang mit der von den wesentlichen Kompetenzträgern als nicht gewünscht und nicht für erforderlich gehaltenen Ergänzungsstation in Stuttgart zu luxuriös vergüteten Kaffeekränzchen getroffen hat.
Es wird höchste Zeit, dass Schlagseite und Zwielicht in der Verkehrspolitik des Landes endlich überwunden werden.“
Krise als Chance für eine moderne Verwaltung nutzen.
In der Beratung des Haushalts des Landtags enthalten sind die Ausgaben für die Mitglieder des Landtags und für die Landtagsverwaltung sowie die Mittel für die Landeszentrale für politische Bildung und die Bürgerbeauftragte des Landes.
Dazu sagt von der FDP/DVP-Fraktion der Parlamentarische Geschäftsführer und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jochen Haußmann:
Zunächst gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung des Landtags und der Landeszentrale für politische Bildung. Sie alle tragen ihren Teil dazu bei, das Gedankengut der freiheitlichen demokratischen Staatsordnung im Bewusstsein der Bevölkerung zu fördern und zu festigen. Nie war das so wichtig wie heute!
Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns, dass wir seit Sommer wieder Besuchergruppen im Landtag haben, an dieser Stelle danke ich dem Besucherdienst für die hervorragende Betreuung unserer Gäste im Landtag.
Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen des 70jährigen Gründungsjubiläums des Landes Baden-Württemberg. 1952 startete die Verwaltung mit bescheidensten Mitteln – mit 3 Frauen, 4 Männer, 3 Schreibmaschinen und 2 Telefonen. Diese Erinnerung an das Gründungsjahr unseres Bundeslandes sollten wir zum Anlass einer umfassenden Aufgabenkritik nehmen. Zum Beispiel halten wir die Bürgerbeauftragte des Landes für entbehrlich, weil wir schon 154 Mitglieder des Landtags als Bürgerbeauftragte haben.
Dies betrifft nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Abgeordneten selbst. Wir wollen, dass der Landtag auch bei sich selbst spart. Aktuell hat der Landtag mit 154 Abgeordneten 34 Abgeordnete mehr als die eigentliche Sollgröße. Das im Frühjahr von Grünen, CDU und SPD beschlossene Wahlrecht wird für eine weitere Aufblähung des Landtags sorgen. Wir wollen dem gegensteuern und haben einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der die Sollgröße des Landtags von 120 Abgeordneten wahren soll, indem die Wahlkreise und damit die Direktmandate auf die Anzahl der Bundestagswahlkreise reduziert werden. Hierfür schlagen wir vor, aus 70 Direktmandaten nur noch 38 zu machen. Das entspricht einerseits dem Vorschlag des Sachverständigen Joachim Behnke, der ca. 40 Wahlkreise für geeignet befunden hat, um die Parlamentsgröße wirksam zu begrenzen und verhindert andererseits kleinteilige Diskussionen über Wahlkreiszuschnitte. Der Einspareffekt für die Mitglieder des Landtags und die Landtagsverwaltung wäre erheblich.“